ISO 14091 & CSRD: Der neue Goldstandard für Klimarisikoanalysen ab 2026
Ab 2026 gelten in der EU neue Standards für Klimarisikoanalysen: ISO 14091 und die Corporate...
Von Johannes Fiegenbaum am 21.08.25 22:08

Das TNFD-Framework bietet Unternehmen einen klaren Fahrplan, um naturbezogene Risiken und Chancen zu verstehen und transparent zu berichten. Angesichts der EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) wird es für deutsche Unternehmen immer wichtiger, Biodiversitätsaspekte in ihre Strategien und Berichte zu integrieren. Mit dem LEAP-Ansatz (Lokalisieren, Bewerten, Einschätzen, Vorbereiten) können Unternehmen gezielt ihre Abhängigkeiten von natürlichen Ressourcen analysieren und Maßnahmen entwickeln. Besonders Branchen wie Landwirtschaft, Chemie oder Bergbau profitieren von einer frühzeitigen Umsetzung, um Risiken zu minimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern.
Die Umsetzung des TNFD-Frameworks ist nicht nur eine Pflicht, sondern eine Chance, langfristig resilienter und transparenter zu agieren. Ihr könnt direkt starten, um euch auf künftige Regulierungen vorzubereiten und eure Stakeholder zu überzeugen.
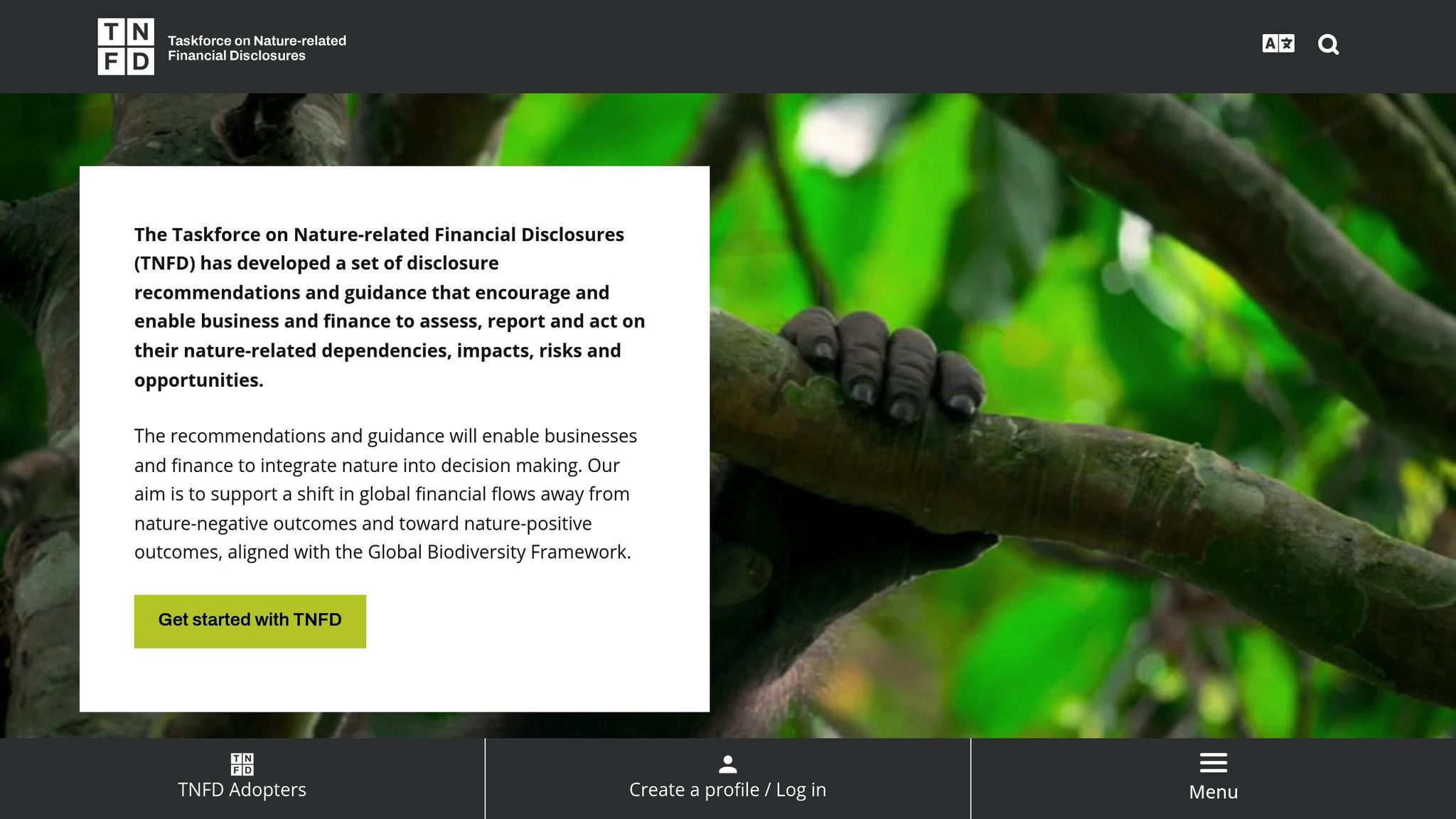
Das TNFD-Framework basiert auf vier zentralen Säulen, die Unternehmen eine strukturierte Herangehensweise für die Berichterstattung zu Biodiversitätsthemen bieten.
Der LEAP-Ansatz ist der methodische Kern des TNFD-Frameworks und bietet Unternehmen eine klare Orientierung, um naturbezogene Themen systematisch zu bewerten.
Die Offenlegungsanforderungen des TNFD-Frameworks sind flexibel gestaltet und für Unternehmen jeder Größe anwendbar. Für jede der vier Säulen werden spezifische Punkte definiert – von qualitativen Angaben zu Governance-Prozessen bis hin zu quantitativen Biodiversitätskennzahlen.
Für deutsche Unternehmen sind sektorspezifische Leitlinien besonders wichtig. Finanzinstitute sollten beispielsweise ihre Kredit- und Investitionspraktiken im Hinblick auf naturbezogene Risiken analysieren. Produzierende Unternehmen hingegen müssen die direkten Auswirkungen ihrer Betriebsabläufe auf Ökosysteme offenlegen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gesamten Wertschöpfungskette: Unternehmen bewerten nicht nur ihre eigenen Aktivitäten, sondern auch die Auswirkungen ihrer Lieferanten und Kunden. Mithilfe einer Wesentlichkeitsanalyse können sie die wichtigsten naturbezogenen Themen für ihr Geschäftsmodell und ihre Stakeholder identifizieren.
Im nächsten Abschnitt erfahrt ihr, wie ihr das TNFD-Framework in der Praxis umsetzen könnt.
Der Einstieg in die Umsetzung der TNFD beginnt mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme der Auswirkungen eurer Geschäftstätigkeiten auf die Biodiversität. Dabei solltet ihr sowohl eure direkten Betriebsstandorte als auch die gesamte Lieferkette unter die Lupe nehmen.
Startet mit einer Bestandsaufnahme aller Geschäftstätigkeiten und deren geografischer Verteilung. Dazu gehören Produktionsstätten, Büros, Lagerhäuser und die wichtigsten Lieferanten entlang der Wertschöpfungskette. Besonders kritisch sind Standorte in der Nähe von Schutzgebieten, Gewässern oder anderen ökologisch sensiblen Bereichen.
Die Einbindung relevanter Interessensgruppen ist in dieser Phase entscheidend. Gespräche mit lokalen Gemeinden, Umweltorganisationen oder wissenschaftlichen Institutionen können euch helfen, ein vollständiges Bild der Auswirkungen zu gewinnen. Einige Unternehmen arbeiten bereits erfolgreich mit Partnern wie NABU zusammen, um ihren ökologischen Fußabdruck besser zu verstehen.
Analysiert außerdem, welche Ökosystemleistungen für eure Geschäftsprozesse entscheidend sind. Braucht ihr beispielsweise sauberes Wasser für die Produktion oder sind eure landwirtschaftlichen Lieferanten auf natürliche Bestäubung angewiesen? Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage, um mit dem LEAP-Ansatz Risiken und Chancen weiter zu konkretisieren.
Nach der ersten Bewertung wird es Zeit, die LEAP-Methode anzuwenden, um eure Analyse zu vertiefen. Die Methode umfasst vier Schritte:
Um eure Fortschritte messbar zu machen, braucht ihr aussagekräftige Kennzahlen. Beginnt mit Basis-Metriken wie Flächenverbrauch, Wassernutzung oder Emissionen in ökologisch sensiblen Gebieten – diese sind relativ leicht zu erfassen.
Für detailliertere Einblicke könnt ihr spezifischere KPIs entwickeln, wie etwa die Anzahl geschützter Arten auf euren Betriebsgeländen, die Qualität der umliegenden Gewässer oder den Anteil naturnaher Flächen in der Lieferkette. Achtet darauf, dass diese Metriken mit regulatorischen Vorgaben wie der EU-Taxonomie-Verordnung kompatibel sind.
Digitale Monitoring-Tools – etwa Sensoren, Satellitendaten oder Apps – können euch helfen, die Datenqualität zu verbessern und den Aufwand für die Berichterstattung zu minimieren. Die erstellten KPIs bilden schließlich die Grundlage für eure ESG-Berichterstattung.
Sobald eure Biodiversitätsdaten vorliegen, integriert sie in eure ESG-Prozesse. Dabei müsst ihr eure Berichterstattungsstrukturen anpassen und die Wesentlichkeitsanalyse um biodiversitätsbezogene Themen erweitern. Das Feedback von Investoren, Kunden und anderen Stakeholdern sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
Organisiert eure Daten entlang der vier TNFD-Säulen, um sowohl die interne Analyse als auch die externe Kommunikation zu erleichtern. Schulungen für euer Berichtsteam sind dabei unerlässlich, da Biodiversität oft andere Datenquellen und Analysen erfordert als klassische ESG-Kennzahlen. Eine integrierte Berichterstattung, die Biodiversität mit Themen wie Klimawandel und sozialen Aspekten verknüpft, wird den Erwartungen eurer Stakeholder gerecht.
Biodiversitätsdaten sind oft unvollständig oder inkonsistent. Beginnt mit verfügbaren Quellen, etwa öffentlichen Datenbanken des Bundesamts für Naturschutz, und arbeitet daran, die Datenqualität schrittweise zu verbessern.
Um Datenlücken zu schließen, könnt ihr Schätzverfahren, Proxy-Indikatoren oder modellbasierte Ansätze nutzen. Wichtig ist, dass ihr diese Methoden transparent dokumentiert und kontinuierlich weiterentwickelt.
Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen können ebenfalls dazu beitragen, die Datenbasis langfristig zu verbessern und eure Analysen zu präzisieren. Solche Kooperationen bieten euch nicht nur Zugang zu besseren Daten, sondern auch zu wertvollem Fachwissen.
Die TNFD stellt eine Reihe von offiziellen Dokumenten und digitalen Tools bereit, die euch den Einstieg erleichtern können. Das kostenlose TNFD-Framework bildet dabei die Grundlage und wird durch branchenspezifische Leitfäden ergänzt, die speziell auf Sektoren wie Landwirtschaft, Finanzdienstleistungen oder Bergbau zugeschnitten sind.
Zusätzlich gibt es digitale Toolkits, die den Implementierungsprozess unterstützen. Dazu gehören Vorlagen für die LEAP-Analyse, Checklisten zur Datensammlung und Beispiele für relevante Kennzahlen. Interaktive Plattformen der TNFD bieten zudem regelmäßig aktualisierte Inhalte, die euch bei der Umsetzung helfen.
Ein bemerkenswerter Schritt: Die deutsche Regierung hat im Dezember 2022 rund 29 Millionen Euro über sechs Jahre in die Entwicklung der TNFD und den Kapazitätsaufbau investiert. Diese Mittel fließen unter anderem in deutschsprachige Ressourcen und Schulungsprogramme. Bereits über 500 Organisationen haben sich freiwillig zur Berichterstattung nach TNFD-Empfehlungen verpflichtet. Ihre Erfahrungen teilen sie über die TNFD-Community-Plattform, wodurch ein wertvoller Austausch entsteht. Ergänzend dazu erleichtern Datenplattformen die praktische Umsetzung, indem sie verschiedene Datenquellen nahtlos integrieren.
Initiativen wie die Nature Data Public Facility verbessern den Zugang zu relevanten Naturdaten – ein entscheidender Vorteil für deutsche Unternehmen. Berichtsplattformen entwickeln sich weiter und integrieren zunehmend TNFD-Anforderungen neben etablierten Standards wie CSRD und GRI. Solche Interoperabilitäts-Tools reduzieren den Aufwand, da sie Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen und automatisch auf Konsistenz prüfen.
Diese Tools sind eine solide Grundlage, doch in vielen Fällen erweist sich zusätzlich die Unterstützung durch spezialisierte Beratungsdienste als wertvoll.
Wenn digitale Tools und Datenplattformen an ihre Grenzen stoßen, bringt professionelle Beratung den entscheidenden Vorteil. Fiegenbaum Solutions bietet speziell auf deutsche Unternehmen zugeschnittene Dienstleistungen zur TNFD-Implementierung. Dazu gehören vollständige LEAP-Analysen, die Entwicklung branchenspezifischer KPIs und die Integration der Ergebnisse in bestehende ESG-Strategien.
Ein häufiges Problem sind Datenlücken. Hier hilft Fiegenbaum Solutions, indem sie fehlende Daten identifizieren, geeignete Proxy-Indikatoren entwickeln und robuste Schätzverfahren etablieren – stets unter Berücksichtigung deutscher Regulierungsanforderungen und internationaler Standards.
Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der strategischen Verankerung von Biodiversität. Anstatt TNFD rein als Berichtspflicht zu sehen, wird Biodiversität als Chance und Instrument für ein besseres Risikomanagement positioniert. Angesichts der Tatsache, dass 55 % des globalen BIP (58 Billionen US-Dollar) materiell von der Natur abhängig sind, ist dies ein zentraler Aspekt.
Die Beratung umfasst auch Szenarioanalysen und Stresstests, um mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich Biodiversität zu bewerten. Laut dem Global Risks Report 2024 des World Economic Forum gehört der Verlust der Biodiversität und der Kollaps von Ökosystemen zu den drei größten globalen Risiken der kommenden Jahrzehnte.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Laut der Global Investor Survey 2023 von PwC möchten 75 % der Befragten wissen, wie sich Unternehmen auf Gesellschaft und Umwelt auswirken. Fiegenbaum Solutions unterstützt Unternehmen dabei, ihre Biodiversitätsleistung so zu kommunizieren, dass sie den Erwartungen von Investoren, Kunden und anderen Stakeholdern gerecht wird.
Die Verbindung von TNFD mit euren ESG- und Klimastrategien stärkt eure Nachhaltigkeitsbemühungen erheblich. Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt sind eng miteinander verwoben und erfordern daher abgestimmte Ansätze. Dabei passt die bewährte Struktur des TNFD-Frameworks hervorragend zu Standards wie TCFD und ISSB, was die Integration in bestehende Berichterstattungsprozesse erleichtert.
Ein früher Start mit TNFD kann deutschen Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile verschaffen. Deutschland unterstützt aktiv die Entwicklung und Einführung des TNFD-Frameworks, unter anderem durch finanzielle Förderungen und die Einrichtung einer nationalen TNFD-Plattform. Fortschritte bei Technologien wie Fernüberwachung, Sensorik, eDNA, Citizen Science, Drohnen und KI machen es zudem möglich, Biodiversität kosteneffizient zu bewerten – ein Pluspunkt, insbesondere für KMU. Wenn ihr frühzeitig eure Abhängigkeiten von natürlichen Ressourcen versteht, könnt ihr Risiken gezielter steuern. Gleichzeitig schafft ihr so die Grundlage, um flexibel und proaktiv auf neue Regulierungen zu reagieren.
Auf EU-Ebene werden bereits erweiterte Anforderungen diskutiert. Die Europäische Kommission plant spezifische Offenlegungspflichten zur Biodiversität, die sich am TNFD-Framework orientieren. Unternehmen, die frühzeitig TNFD-konforme Prozesse einführen, sind besser auf diese kommenden regulatorischen Entwicklungen vorbereitet und können sich einen strategischen Vorsprung sichern.
Die Einbindung des TNFD-Frameworks ist für deutsche Unternehmen keine optionale Entscheidung, sondern ein strategischer Schritt, um zukunftssicher zu bleiben. Biodiversitätsrisiken haben direkte Auswirkungen auf eure finanziellen Ergebnisse und können eure Geschäftstätigkeit erheblich beeinflussen. Mit seinen vier Säulen bietet das TNFD-Framework einen klaren Ansatz, um naturbezogene Risiken besser zu verstehen und zu steuern.
Ein großer Vorteil liegt in der einfachen Integration in bestehende ESG-Berichterstattungen und Klimastrategien. Unternehmen, die jetzt aktiv werden, sichern sich einen Vorsprung bei künftigen EU-Vorgaben zur Biodiversitätsberichterstattung und können gleichzeitig operative Effizienzgewinne erzielen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr TNFD schrittweise in eure Prozesse einbinden könnt.
Sofortige Maßnahmen:
Mittelfristige Schritte:
Langfristige Integration:

Falls ihr euch Unterstützung bei der Umsetzung wünscht, ist Fiegenbaum Solutions euer verlässlicher Partner. Das Team bietet maßgeschneiderte Beratungsansätze, die von der ersten Biodiversitätsbewertung bis zur Integration in eure ESG-Strategie reichen.
Johannes Fiegenbaum bringt Praxiswissen und regulatorische Expertise zusammen, um euch dabei zu helfen, spürbare Fortschritte bei der TNFD-Umsetzung zu erzielen. Besonders hilfreich ist die Verknüpfung von Biodiversitätsstrategien mit Klimarisikomanagement und CSRD-Compliance – ein Ansatz, der Synergien schafft und den Aufwand für Berichterstattung reduziert.
Dank flexibler Zusammenarbeitsmodelle könnt ihr sowohl spezifische Projekte umsetzen als auch langfristige Partnerschaften eingehen. Für eine kostenlose Erstberatung und individuelle Lösungsvorschläge steht euch das Team von Fiegenbaum Solutions jederzeit zur Verfügung.
Mit diesen Schritten könnt ihr TNFD nahtlos in eure ESG-Strategie integrieren und damit einen wichtigen Beitrag zu eurem nachhaltigen Unternehmenserfolg leisten.
Die Integration des TNFD-Frameworks in eure ESG-Strategie beginnt mit dem LEAP-Prozess (Locate, Evaluate, Assess, Prepare). Dieser Ansatz ermöglicht es, systematisch zu analysieren, welche Abhängigkeiten euer Unternehmen von der Natur hat und welche Auswirkungen eure Geschäftstätigkeit auf diese hat. Dabei solltet ihr unbedingt bestehende EU-Regulierungen wie die CSRD berücksichtigen. So könnt ihr Synergien nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihr alle regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Für die Umsetzung ist es entscheidend, klare Governance-Strukturen zu schaffen. Naturbezogene Risiken und Chancen sollten fest in eure Strategien eingebunden werden, ergänzt durch messbare Ziele und Metriken. Wer frühzeitig handelt, profitiert gleich mehrfach: Eine verbesserte Risikobewertung, leichterer Zugang zu nachhaltigem Kapital und eine stärkere Glaubwürdigkeit bei Investoren sind nur einige der Vorteile. Ein strukturierter Ansatz bietet zudem die Möglichkeit, langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern und die nachhaltige Ausrichtung eures Unternehmens zu stärken.
Die frühzeitige Anwendung des TNFD-Frameworks bietet deutschen Unternehmen die Chance, sich gezielt auf kommende EU-Vorgaben einzustellen. So können naturbezogene Risiken rechtzeitig erkannt und aktiv gemanagt werden, was dabei hilft, regulatorische Anforderungen vorausschauend zu erfüllen.
Darüber hinaus stärkt dies die Wettbewerbsfähigkeit und sorgt für mehr Klarheit in der Berichterstattung. Unternehmen, die Biodiversität frühzeitig in ihre ESG-Strategie einbinden, können nicht nur neue Marktpotenziale erschließen, sondern sich auch als Vorreiter einer nachhaltigen Unternehmensführung präsentieren.
Unternehmen begegnen bei der Anwendung des TNFD-Frameworks oft Hindernissen wie begrenzter Datenverfügbarkeit, variierender Datenqualität und schwierigem Zugang zu zuverlässigen Naturdaten. Diese Probleme entstehen häufig durch das Fehlen einheitlicher Standards und eine fragmentierte Datenlandschaft.
Eine Lösung besteht darin, gemeinsame Datenstandards zu etablieren, Kooperationen für den Datenaustausch zu fördern und moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz oder automatisierte Analysen zu nutzen. Solche Ansätze können nicht nur die Datenqualität verbessern, sondern auch den Zugang zu relevanten Informationen erleichtern.
Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen können Unternehmen die Anforderungen des TNFD-Frameworks besser erfüllen und naturbezogene Risiken sowie Chancen effektiver steuern.

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonAb 2026 gelten in der EU neue Standards für Klimarisikoanalysen: ISO 14091 und die Corporate...
Wie schützt ihr euer Unternehmen vor Klimarisiken? Der Standard ISO 14091 bietet euch einen klaren...
APIs für ESG-Daten ermöglichen Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten effizient zu verwalten, Berichte...