Der ultimative Leitfaden für ESG-Fragebögen: Relevanz, Komponenten und Datenerhebung verstehen
In diesem umfassenden Leitfaden erhalten kleine und mittelständische Unternehmen eine Übersicht zum...
Von Johannes Fiegenbaum am 23.08.25 06:03

Deutsche Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen in der ESG-Berichterstattung. Mit der CSRD und den ESRS steigen die Anforderungen an die Datenerhebung und -verarbeitung enorm. Über 50.000 Unternehmen bereiten sich darauf vor, mehr als 1.000 Datenpunkte detailliert offenzulegen – manuelle Methoden wie Excel stoßen hier schnell an ihre Grenzen.
Die Lösung? Automatisierung. Moderne ESG-Software integriert sich nahtlos in ERP-Systeme, reduziert den Aufwand um bis zu 70 % und verbessert die Datenqualität. APIs ermöglichen einen effizienten Austausch von Energie-, Lieferketten- und sozialen Daten. Gleichzeitig sorgen standardisierte Formate wie XBRL und Audit-Trails für Compliance und Transparenz.
Eure Vorteile auf einen Blick:
Was ist wichtig? Die richtige Auswahl und Implementierung der Tools – von API-Integrationen bis hin zu DSGVO-konformen Lösungen. Mit den passenden Systemen bleibt ihr nicht nur compliant, sondern könnt eure ESG-Ziele effizient steuern und langfristig Wettbewerbsvorteile sichern.
Die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) bringt klare Vorgaben für die ESG-Berichterstattung in Deutschland mit sich. Große, kapitalmarktorientierte Unternehmen sind verpflichtet, ihre Berichte gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zu erstellen. Diese umfassen zwölf thematische Standards, die Themen wie Klimawandel, Arbeitsbedingungen und weitere Nachhaltigkeitsaspekte abdecken.
Zusätzlich dazu stellt die EU-Taxonomie spezifische Anforderungen an nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Unternehmen in Deutschland müssen beispielsweise Umsätze, Investitionen und Betriebsausgaben, die taxonomiefähig oder -konform sind, sowohl prozentual als auch in Euro ausweisen. Automatisierte Systeme spielen hier eine zentrale Rolle: Sie ordnen Geschäftstätigkeiten eigenständig den relevanten NACE-Codes zu und setzen die Berechnungsregeln der Taxonomie-Verordnung um.
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) erhöht den Druck zusätzlich. Seit dem 1. Januar 2023 müssen Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten ihre Lieferketten auf Risiken im Bereich Menschenrechte und Umwelt überwachen. Ab 2024 gilt dies bereits für Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Automatisierte ESG-Lösungen müssen in der Lage sein, Lieferantendaten in Echtzeit auszuwerten und fundierte Risikobewertungen zu erstellen.
Diese regulatorischen Rahmenbedingungen bilden die Grundlage, auf der technische Lösungen für ESG-Datenautomatisierung aufbauen müssen.
Manuelle Prozesse stoßen schnell an ihre Grenzen – hier sind durchdachte technische Lösungen gefragt. Robuste API-Integrationen sind unverzichtbar, um bestehende ERP-Systeme wie SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics oder Oracle Cloud nahtlos einzubinden. Diese Schnittstellen ermöglichen eine bidirektionale Datenübertragung, sowohl für Stammdaten als auch für berechnete ESG-Kennzahlen.
Für eine effiziente Datenverarbeitung und -übertragung sind standardisierte Formate wie XBRL entscheidend. Systeme müssen das European Single Electronic Format (ESEF) unterstützen und Berichte automatisch in das iXBRL-Format konvertieren können. Darüber hinaus sind Integrationen mit Energiemanagementsystemen nach ISO 50001 sowie Umweltmanagementsystemen nach ISO 14001 erforderlich.
Ein weiteres Muss sind Audit-Trails und Versionskontrollen, die jede Datenänderung – sei es ein Import, eine Berechnung oder eine manuelle Anpassung – protokollieren. Diese Nachverfolgbarkeit ist essenziell, da die CSRD eine externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte vorschreibt.
Die Sicherstellung der Datenqualität ist ebenso wichtig. Automatisierte Plausibilitätsprüfungen und Validierungen helfen dabei, Ausreißer zu erkennen, fehlende Werte zu markieren und Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Datenquellen aufzudecken. All das sorgt dafür, dass die Berichterstattung nicht nur korrekt, sondern auch effizient gestaltet werden kann.
Deutsche Unternehmen haben spezielle Anforderungen, die bei der ESG-Datenautomatisierung berücksichtigt werden müssen. Alle Berichte müssen die deutschen Standards für Währung (z. B. 1.234.567,89 €), Datum (TT.MM.JJJJ) und Maßeinheiten (z. B. kWh, t CO₂e, m³, °C) einhalten. Auch regionale Besonderheiten wie deutsche Feiertage müssen in die Systeme integriert sein.
Darüber hinaus erwarten Unternehmen, dass Benutzeroberflächen, Berichte und Fehlermeldungen vollständig auf Deutsch verfügbar sind – und zwar mit korrekten Fachbegriffen wie "Wesentlichkeitsanalyse", "Nachhaltigkeitsstrategie" oder "Lieferkettensorgfaltspflicht". Auch die Abbildung deutscher Rechtsformen wie GmbH, AG oder KGaA muss einwandfrei funktionieren.
Ein weiterer zentraler Punkt ist der Datenschutz nach DSGVO. Systeme müssen Privacy by Design umsetzen und personenbezogene Daten, etwa von Mitarbeitenden oder Lieferanten, pseudonymisieren. Das betrifft insbesondere sensible Informationen wie Gesundheits- und Sicherheitsdaten oder Angaben zu Diversität und Inklusion. Darüber hinaus müssen Funktionen wie das Recht auf Löschung und Datenübertragbarkeit technisch gewährleistet sein.
APIs sind das Rückgrat moderner Datenintegration – gerade im ESG-Bereich spielen sie eine zentrale Rolle. Sie verbinden verschiedene Systeme und ermöglichen einen automatisierten Datenaustausch, der nahtlos und effizient abläuft. Im ESG-Kontext bedeutet das: APIs verknüpfen interne Systeme wie ERP- und Energiemanagementlösungen mit externen Quellen, beispielsweise Lieferantenportalen oder globalen Datenbanken, und schaffen so ein konsistentes Netzwerk aus Informationen.
Besonders die REST-API-Technologie hat sich hier bewährt. Sie erlaubt es ESG-Plattformen, operative Daten in Echtzeit abzurufen, Emissionsfaktoren aus externen Quellen zu importieren oder Lieferantendaten zu synchronisieren. Mithilfe von Webhooks können Systeme zudem automatisch auf wichtige Datenänderungen reagieren – ein Plus für die Aktualität und Effizienz. Die Datenübertragung erfolgt in standardisierten Formaten wie JSON oder XML, was nicht nur die Integration erleichtert, sondern auch die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie der CSRD oder der EU-Taxonomie unterstützt.
Diese Basis ermöglicht es ESG-Automatisierungstools, ihre Stärken voll auszuspielen und Datenkonsistenz sowie -berechnungen zuverlässig sicherzustellen.
Moderne ESG-Automatisierungstools bieten weit mehr als nur Datenverwaltung – sie sorgen für eine durchgängige Harmonisierung und Qualitätssicherung der Daten. Informationen aus unterschiedlichsten Quellen werden in ein einheitliches Format überführt, sodass Maßeinheiten und Darstellungen – zum Beispiel bei Emissionsdaten – standardisiert und vergleichbar werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Berichterstattung den regulatorischen Anforderungen entspricht.
Ein weiteres Highlight: Erweiterte Berechnungsmodule. Diese ermöglichen es, präzise Kennzahlen für die Berichterstattung nach CSRD oder EU-Taxonomie zu ermitteln. Automatisierte Prozesse minimieren dabei das Risiko manueller Fehler und sorgen für eine zuverlässige, konsistente Datenauswertung – ein echter Mehrwert für Unternehmen, die sich auf ihre ESG-Verpflichtungen konzentrieren.
Datensicherheit ist im ESG-Reporting ein absolutes Muss, und hier kommen bewährte Standards ins Spiel. DSGVO-konforme Datenübertragungen werden durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und aktuelle TLS-Protokolle gewährleistet. Ergänzend sorgen Authentifizierungsverfahren wie OAuth 2.0 und tokenbasierte Ansätze (z. B. JSON Web Tokens) dafür, dass nur autorisierte Nutzer Zugriff auf sensible Informationen haben. Jede API-Anfrage wird zudem protokolliert, um maximale Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.
Damit APIs auch den Anforderungen innerhalb der EU gerecht werden, müssen sie problemlos mit nationalen Berichtsportalen und regulatorischen Systemen zusammenarbeiten können. Funktionen wie API-Rate-Limiting und kontinuierliches Monitoring tragen dazu bei, einen stabilen und sicheren Datenaustausch in Echtzeit zu gewährleisten. Das ist besonders wichtig, um die Vorgaben der CSRD und der EU-Taxonomie zuverlässig einzuhalten.
Der Markt für ESG-Automatisierungstools entwickelt sich rasant weiter, um den Anforderungen der CSRD und der EU-Taxonomie gerecht zu werden. Die verfügbaren Lösungen sind vielfältig: Einige konzentrieren sich auf präzise Emissionsberechnungen für Scope 1, 2 und 3, während andere einen umfassenderen Ansatz für das ESG-Management verfolgen.
Typische Funktionen dieser Tools umfassen:
Ein genauer Blick auf die verfügbaren Tools und ihre Funktionalitäten lohnt sich, um die passende Lösung für euer Unternehmen zu finden.
Die API-Integrationsmöglichkeiten sind ein zentraler Aspekt bei der Auswahl eines geeigneten Tools. Doch ebenso wichtig ist es, die spezifischen Funktionen und die Anpassungsfähigkeit der Lösungen zu bewerten. Unternehmen sollten dabei ihre individuellen Anforderungen und die bestehende IT-Infrastruktur im Blick behalten.
Worauf kommt es an?
Ein ideales ESG-Tool unterstützt nicht nur den Datenaustausch, sondern ist auch darauf vorbereitet, zukünftige regulatorische Änderungen problemlos umzusetzen. So bleibt euer Unternehmen nicht nur compliant, sondern auch zukunftssicher.
Der Weg zur ESG-Datenautomatisierung erfordert eine durchdachte Herangehensweise. Mit einer klaren Strategie und den passenden Tools könnt ihr technische und strategische Herausforderungen meistern und den Prozess effizient gestalten.
Phase 1: Systemanalyse und Bestandsaufnahme ist der erste Schritt. Hierbei werden sämtliche Datenquellen erfasst – von ERP-Systemen über Energiemanagementsoftware bis hin zu manuellen Excel-Tabellen. Ziel ist es, Datensilos zu identifizieren und ein vollständiges Bild der vorhandenen Infrastruktur zu erhalten.
Phase 2: API-Integration und Schnittstellenentwicklung bildet das technische Rückgrat der Automatisierung. Über REST-APIs können ESG-Tools Daten in Echtzeit aus verschiedenen Quellen abrufen. Der Fokus liegt zunächst auf zentralen Datenströmen wie Energieverbrauch und CO₂-Emissionen. Eine hohe Datenqualität ist dabei unverzichtbar, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
Phase 3: Compliance-Verifizierung und Validierung sorgt dafür, dass alle automatisierten Prozesse den Vorgaben der CSRD und der EU-Taxonomie entsprechen. Kontrollmechanismen und Audit-Trails gewährleisten die Nachvollziehbarkeit und Korrektheit der Daten.
Parallel zur Einführung wird eine Testphase durchgeführt, um mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. So können kleinere Anpassungen vorgenommen werden, ohne dass die Compliance gefährdet wird.
Mit diesen Schritten schafft ihr eine solide Basis, auf der Fiegenbaum Solutions euch mit umfassender Unterstützung begleitet.
Fiegenbaum Solutions, gegründet von Johannes Fiegenbaum, verbindet tiefgehendes regulatorisches Wissen mit praktischer Umsetzungserfahrung. Die Beratung deckt wichtige Themen wie ESG-Strategie, Lifecycle Assessments (LCA), Dekarbonisierung und CSRD-Compliance ab – alles entscheidende Bausteine für die Automatisierung.
Die projektbasierte Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Herausforderungen, etwa die Integration komplexer Scope-3-Berechnungen oder die Anpassung an branchenspezifische Standards. Besonders hilfreich ist die Expertise im Umgang mit deutschen Vorschriften und Geschäftsprozessen.
Für Unternehmen, die langfristige Unterstützung benötigen, sind Retainer-Vereinbarungen ideal. Diese flexible Lösung berücksichtigt die sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen und ermöglicht eine kontinuierliche Weiterentwicklung der ESG-Automatisierung. Die Preisgestaltung wird dabei an die Größe und Komplexität des Unternehmens angepasst.
Startups und impact-orientierte Unternehmen profitieren von speziellen Konditionen, die auf die Bedürfnisse wachstumsstarker Organisationen zugeschnitten sind. Johannes Fiegenbaum bringt nicht nur ESG-Expertise, sondern auch unternehmerisches Denken mit, was besonders für diese Zielgruppe einen Mehrwert schafft.
Die transparente Preisgestaltung sorgt für Planungssicherheit: Nach einem ersten Gespräch erhaltet ihr einen detaillierten Vorschlag mit klar definiertem Arbeitsumfang, Zeitplan und Kosten. So behaltet ihr die Kontrolle über euer Budget.
Nach der erfolgreichen Implementierung unterstützt Fiegenbaum Solutions euch mit einem kontinuierlichen Monitoring, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen.
Eine erfolgreiche Automatisierung endet nicht mit der Implementierung. Regelmäßiges Monitoring und Qualitätssicherung sind entscheidend, um langfristig erfolgreich und compliance-sicher zu bleiben.
Automatisierte Datenqualitätsprüfungen laufen im Hintergrund und erkennen Anomalien oder fehlende Datenpunkte sofort. Mithilfe statistischer Analysen können ungewöhnliche Abweichungen, wie ein plötzlicher Anstieg des Energieverbrauchs um mehr als 20 %, schnell identifiziert und untersucht werden.
Die Audit-Readiness wird durch lückenlose Dokumentation aller Datenverarbeitungsschritte gewährleistet. ESG-Systeme erstellen automatisch Prüfpfade, die zeigen, welche Daten wann und wie verarbeitet wurden. Diese Transparenz erleichtert externe Audits und unterstützt die interne Qualitätssicherung.
Monatliche Compliance-Reviews stellen sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten werden. Dabei werden nicht nur aktuelle Pflichten geprüft, sondern auch kommende gesetzliche Änderungen berücksichtigt – etwa die schrittweise Erweiterung der EU-Taxonomie um neue Umweltziele.
Das Performance-Monitoring der API-Schnittstellen sorgt dafür, dass Datenübertragungen reibungslos funktionieren. Besonders bei der Integration von Lieferantendaten für Scope-3-Berechnungen ist dies entscheidend, da Verzögerungen oder Ausfälle die Vollständigkeit der Berichterstattung gefährden könnten.
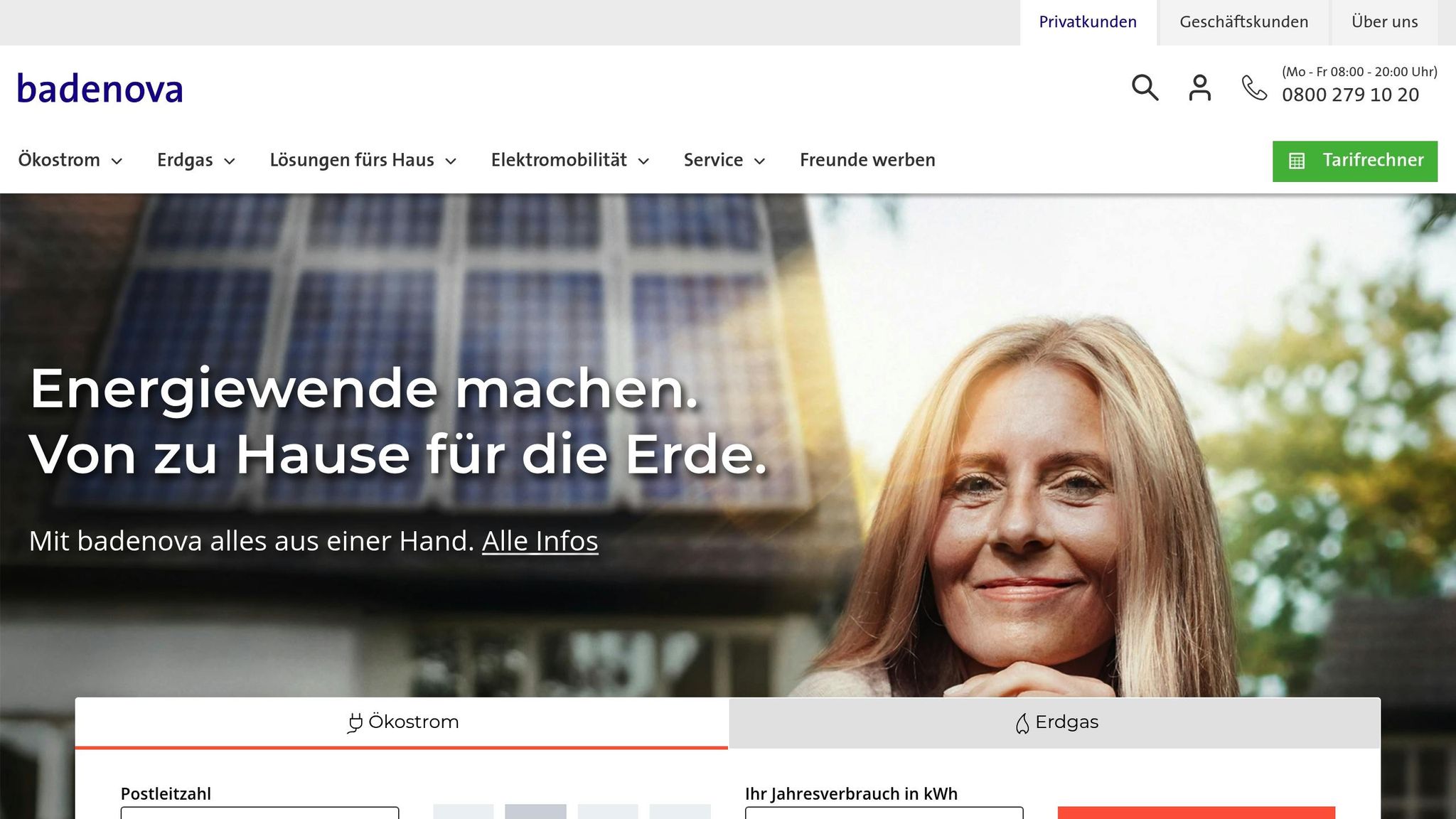
Die Automatisierung im ESG-Reporting entwickelt sich rasant weiter, und neue Technologien versprechen, die Prozesse noch präziser und effizienter zu gestalten. Besonders Künstliche Intelligenz (KI) und fortschrittliche Analysemethoden spielen dabei eine zentrale Rolle.
KI und maschinelles Lernen im ESG-Reporting
Maschinelles Lernen ermöglicht es, Muster in Energieverbrauchsdaten zu erkennen und komplexe Analysen, wie etwa die Risikoabschätzung in der Scope-3-Berichterstattung, zu automatisieren. Besonders für Unternehmen mit weit verzweigten Lieferketten bringt dies enorme Vorteile: KI kann Lieferantendaten analysieren und potenzielle Risiken in der Wertschöpfungskette frühzeitig identifizieren, wodurch der manuelle Aufwand erheblich reduziert wird.
Prädiktive Analysen für proaktives Management
Mit prädiktiver Analytik können Unternehmen ESG-Risiken nicht nur rückblickend bewerten, sondern auch vorausschauend handeln. Zum Beispiel lassen sich Umweltziele wie CO₂-Reduktionen überwachen, und Algorithmen können frühzeitig darauf hinweisen, wenn diese gefährdet sind. So können rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Diese Entwicklungen werden durch den Einsatz von IoT-Sensoren unterstützt, die eine dynamische und kontinuierliche Datenerfassung ermöglichen.
Echtzeitüberwachung dank IoT-Sensoren
Die Echtzeitüberwachung wird zunehmend zum Standard, insbesondere für börsennotierte Unternehmen. IoT-Sensoren in Produktionsanlagen liefern kontinuierlich Umweltdaten an zentrale ESG-Plattformen. Dadurch können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsberichte in kürzeren Intervallen – beispielsweise quartalsweise oder monatlich – erstellen und den gestiegenen Transparenzanforderungen von Investoren gerecht werden. Diese Echtzeitdaten ergänzen die traditionellen jährlichen Berichtszyklen und verbessern die Transparenz im ESG-Management erheblich.
Satellitendaten für globale Lieferketten
Ein weiterer Fortschritt ist die Integration von Satellitendaten, die es ermöglicht, Umweltveränderungen wie Entwaldung oder Landnutzungsänderungen nahezu in Echtzeit zu überwachen. Für Unternehmen mit globalen Lieferketten bedeutet das, dass sie nicht mehr allein auf die Selbstauskünfte ihrer Zulieferer angewiesen sind. Dies stärkt die Glaubwürdigkeit der ESG-Berichterstattung und bietet eine unabhängige Datenquelle.
Blockchain für manipulationssichere ESG-Daten
Die Blockchain-Technologie wird zunehmend genutzt, um ESG-Daten sicher und nachvollziehbar zu dokumentieren. Besonders in Lieferketten kann sie dabei helfen, die Herkunft von Rohstoffen wie Kobalt oder Lithium lückenlos nachzuverfolgen. In der deutschen Automobilindustrie laufen bereits erste Pilotprojekte, die auf Blockchain-basierte Systeme setzen.
Standardisierung und APIs
Auch die Standardisierung von ESG-Schnittstellen (APIs) schreitet voran. Initiativen wie die Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) arbeiten an einheitlichen Lösungen, um den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen zu erleichtern. Dies senkt den Integrationsaufwand und reduziert die Komplexität bei der Implementierung unterschiedlicher ESG-Tools.
Natürliche Sprachverarbeitung für ESG-Berichte
Natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) bietet eine spannende Möglichkeit, ESG-Berichte effizienter zu erstellen. KI-Systeme können narrative Texte generieren, die komplexe Datensätze in eine verständliche Sprache übersetzen. Das erleichtert die Kommunikation mit Stakeholdern, die nicht über tiefgehende ESG-Kenntnisse verfügen.
Regulatorische Anforderungen als Innovationstreiber
Die zunehmenden regulatorischen Vorgaben, wie etwa die Erweiterung der CSRD-Anforderungen, treiben die Entwicklung automatisierter Lösungen weiter voran. Unternehmen, die frühzeitig in leistungsfähige Automatisierungsinfrastrukturen investieren, werden besser auf zukünftige Verschärfungen vorbereitet sein. Diese Trends bauen auf bestehenden Technologien auf und stellen sicher, dass Unternehmen sowohl regulatorisch als auch operativ gut gerüstet bleiben.
Die Automatisierung von ESG-Daten bietet Unternehmen eine enorme Erleichterung, wenn es darum geht, die Vorgaben der CSRD und der EU-Taxonomie zu erfüllen. Durch automatisierte Prozesse wie die Datenerfassung, -verarbeitung und -berichterstattung wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Genauigkeit und Konsistenz der Nachhaltigkeitsdaten verbessert. Das macht es einfacher, gesetzliche Anforderungen einzuhalten und Berichte vergleichbar zu gestalten.
Ein weiterer Vorteil: Solche Systeme ermöglichen eine Analyse und Überwachung der ESG-Daten in Echtzeit. Das minimiert Risiken und schafft mehr Transparenz für eure Stakeholder. So können Unternehmen nicht nur komplexe Berichtspflichten bewältigen, sondern auch fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten treffen.
APIs ermöglichen es euch, ESG-Daten reibungslos in eure bestehenden ERP-Systeme zu integrieren. Sie sorgen für einen automatisierten Datenaustausch zwischen verschiedenen Plattformen, was die Datenerfassung nicht nur schneller, sondern auch präziser macht – und das bei deutlich weniger Fehleranfälligkeit.
Darüber hinaus bieten APIs klare Vorteile für das ESG-Reporting. Mit Funktionen wie der Überwachung von Daten in Echtzeit, automatischen Updates und direkten Verbindungen zu relevanten Systemen wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert. Das Ergebnis? Eine deutlich verbesserte Datenqualität, die euch hilft, Anforderungen wie der CSRD oder der EU-Taxonomie sicher und effizient gerecht zu werden.
In Deutschland stehen Unternehmen, die ESG-Daten automatisieren möchten, vor der Herausforderung, sowohl technische als auch gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Es ist entscheidend, dass beide Aspekte sorgfältig berücksichtigt werden, um nicht nur den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, sondern auch Vertrauen und Effizienz zu fördern.
Auf technischer Ebene müssen die eingesetzten Tools den Vorgaben der EU-Offenlegungsverordnung (EU-OLV) sowie den technischen Regulierungsstandards (TRS) entsprechen. Diese Vorschriften definieren klare Richtlinien dafür, wie ESG-Daten offengelegt und geschützt werden sollen. Dabei spielen insbesondere Sicherheitsmaßnahmen und einheitliche Datenstandards eine zentrale Rolle, um Datenschutz und Datensicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Unternehmen sollten darauf achten, dass ihre Systeme nicht nur leistungsfähig, sondern auch sicher und regelkonform sind.
Neben den technischen Aspekten sind auch gesetzliche Vorgaben wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die EU-Taxonomie von großer Bedeutung. Diese Richtlinien verlangen eine präzise, transparente Berichterstattung über Nachhaltigkeitsfaktoren. Ziel ist es, die Einhaltung von Compliance-Vorgaben sicherzustellen und gleichzeitig nachhaltige Finanzierungen zu unterstützen. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass ihre ESG-Tools in der Lage sind, diese Anforderungen vollständig abzubilden und die relevanten Berichtsstandards einzuhalten. Nur so können sie den steigenden Anforderungen des Marktes und der Gesetzgebung gerecht werden.
Zusammengefasst ist eine sorgfältige Abstimmung zwischen technischer Umsetzung und gesetzlicher Konformität unerlässlich, um in der ESG-Berichterstattung erfolgreich zu sein.

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonIn diesem umfassenden Leitfaden erhalten kleine und mittelständische Unternehmen eine Übersicht zum...
Kleine und mittlere Unternehmen (VSMEs) müssen bald die neuen EU-Nachhaltigkeitsstandards (ESRS)...
Entdecke, wie Startups und VCs durch die frühzeitige Integration von Umwelt-, Sozial- und...