PPAs und CSRD: Können langfristige Energieverträge helfen, eure Berichtspflichten zu erfüllen?
Wusstest du, dass Power Purchase Agreements (PPAs) nicht nur eure Energiekosten stabilisieren,...
Von Johannes Fiegenbaum am 21.08.25 21:29

Wasserrisiken können Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen stellen: von Wasserknappheit und strengeren Regulierungen bis hin zu Konflikten mit lokalen Gemeinden. Diese Risiken betreffen nicht nur eure Produktion, sondern auch Lieferketten und Investorenbeziehungen. Ab 2025 verschärfen zudem EU-Vorgaben wie die CSRD und die EU-Taxonomie die Berichtspflichten.
Was könnt ihr tun? Eine systematische Wasserrisikobeurteilung hilft euch, Schwachstellen zu erkennen, Kosten zu senken und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Tools wie der Aqueduct Water Risk Atlas und das GEMI Local Water Tool unterstützen euch dabei, globale Risiken zu analysieren und standortspezifische Maßnahmen zu entwickeln. Der Schlüssel liegt in einer Kombination aus Datenanalyse, lokalem Verständnis und klaren Aktionsplänen.
Mit der richtigen Strategie könnt ihr nicht nur Risiken minimieren, sondern auch Wettbewerbsvorteile schaffen. Wie das konkret funktioniert, erfahrt ihr im Artikel.
Eine gründliche Wasserrisikobeurteilung beginnt mit der Sensibilisierung auf Führungsebene. Es ist entscheidend, dass ihr erkennt, wie Wasserrisiken die gesamte Wertschöpfungskette beeinflussen können. Der erste Schritt besteht darin, alle Geschäftsbereiche zu identifizieren, die von Wasser abhängig sind, und deren strategische Relevanz zu bewerten.
Anschließend folgt die Analyse der Wertschöpfungskette. Hierbei werden Lieferanten, Produktionsstandorte und Vertriebswege daraufhin untersucht, wie stark sie von Wasserressourcen abhängen. Besonders kritisch sind Zulieferer in wasserarmen Regionen oder Branchen mit hohem Wasserverbrauch, wie etwa die Textil- oder Chemieindustrie. Es gilt, geografische Hotspots zu identifizieren, die potenzielle Risiken bergen.
Der dritte Schritt ist die standortspezifische Detailanalyse. Dabei wird jeder Produktionsstandort einzeln betrachtet, unter Berücksichtigung der lokalen Wasserverfügbarkeit, der Qualitätsanforderungen und der regulatorischen Rahmenbedingungen. Es ist wichtig, nicht nur die aktuellen Bedingungen zu analysieren, sondern auch zukünftige Entwicklungen wie Klimawandel oder demografische Veränderungen einzubeziehen.
Diese Schritte schaffen eine solide Grundlage, um messbare Risikoparameter zu definieren und zu bewerten.
Wasserstress-Scores sind ein zentraler Bestandteil der Risikobewertung. Diese Skala von 0 bis 5 zeigt, wie stark die Wasserressourcen einer Region beansprucht werden. Werte über 4,0 deuten auf eine extreme Belastung hin und erfordern sofortige Maßnahmen. Der Score basiert auf dem Verhältnis zwischen Wasserentnahme und erneuerbaren Ressourcen.
Die Wasserentnahmerate gibt den jährlichen Wasserverbrauch eines Standorts in Kubikmetern an und setzt diesen in Relation zur lokalen Verfügbarkeit. Besonders aussagekräftig wird diese Kennzahl, wenn sie nach Wasserquellen wie Oberflächenwasser, Grundwasser oder aufbereitetem Abwasser differenziert wird, da jede Quelle unterschiedliche Risiken birgt.
Die regulatorische Exposition bewertet das Risiko durch Gesetzesänderungen. Dabei spielen politische Stabilität, Umweltstandards und die Häufigkeit von Regeländerungen eine Rolle. In Deutschland beispielsweise erhöhen die strengeren Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinien die regulatorischen Anforderungen.
Wasserqualitätsindizes analysieren sowohl eingehende als auch ausgehende Wasserströme. Aspekte wie pH-Wert, Schwermetallgehalt oder biologische Belastung werden geprüft. Verschlechterungen der Eingangsqualität können die Kosten für die Wasseraufbereitung steigern, während Probleme bei der Abwasserqualität zu Sanktionen führen können.
Eine umfassende Risikobewertung entsteht durch die Verknüpfung interner Betriebsdaten mit externen Risikodaten. Interne Daten umfassen den Wasserverbrauch, die Kosten für Beschaffung und Aufbereitung, historische Störungen sowie Investitionen in wassersparende Technologien. Diese Informationen stammen aus Quellen wie Umweltmanagementsystemen oder Produktionsberichten.
Externe Datenquellen liefern den geografischen und klimatischen Kontext. Dazu gehören satellitengestützte Niederschlagsmessungen, hydrologische Modelle und demografische Vorhersagen. Besonders wertvoll sind Daten über konkurrierende Wassernutzer in der Region, da diese das verfügbare Wasserangebot beeinflussen können.
Die Datenintegration erfolgt häufig über geografische Informationssysteme (GIS), die Standortdaten mit regionalen Risikokarten kombinieren. Moderne Plattformen ermöglichen es, Echtzeitdaten von Wetterstationen, Pegelmessungen oder Grundwasserständen einzubinden. Diese kontinuierliche Überwachung hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen.
Eine sorgfältige Validierung und Plausibilitätsprüfung der Daten ist unerlässlich. Interne Verbrauchsdaten sollten mit externen Benchmarks abgeglichen werden, um Fehler oder Ausreißer zu identifizieren. Historische Ereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen können als Referenzpunkte genutzt werden, um die Genauigkeit der Risikomodelle zu überprüfen. Mit diesen integrierten Erkenntnissen könnt ihr eure ESG-Strategien gezielt und effektiv ausrichten.
Es gibt spezialisierte Tools, die Unternehmen dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen im Wasserrisikomanagement zu treffen. Sie verbinden wissenschaftlich fundierte Daten mit benutzerfreundlichen Oberflächen. Zwei zentrale Werkzeuge, die den gesamten Bewertungsprozess erleichtern, stellen wir euch hier vor.
Der Aqueduct Water Risk Atlas des World Resources Institute (WRI) gehört zu den führenden Tools für die globale Analyse von Wasserrisiken. Mit einer wissenschaftlich geprüften Methodik erstellt die Plattform detaillierte und anpassbare Karten zu verschiedenen Wasserproblemen. Die neueste Version, Aqueduct 4.0 (veröffentlicht im August 2023), bietet noch präzisere Daten und erweiterte Funktionen.
Das Tool deckt physische Risiken wie Überschwemmungen, Dürren und Wasserstress ab, berücksichtigt aber auch regulatorische und Reputationsrisiken – ein wichtiger Punkt für deutsche Unternehmen, die sich an strenge EU-Vorgaben halten müssen. Dank der Analyse auf Einzugsgebietsebene lassen sich Risiken für spezifische Standorte genau bewerten. Über die Aqueduct Alliance bietet das WRI zudem strategische Beratung und branchenspezifische Einblicke für Unternehmen.
Besonders für international tätige Unternehmen ist die globale Vergleichbarkeit der Daten von großem Vorteil. Die Plattform wird alle 4–5 Jahre aktualisiert. Mit der neuesten Version können Nutzer durch den Zugang zu hydrologischen Modellen noch tiefere Analysen durchführen.
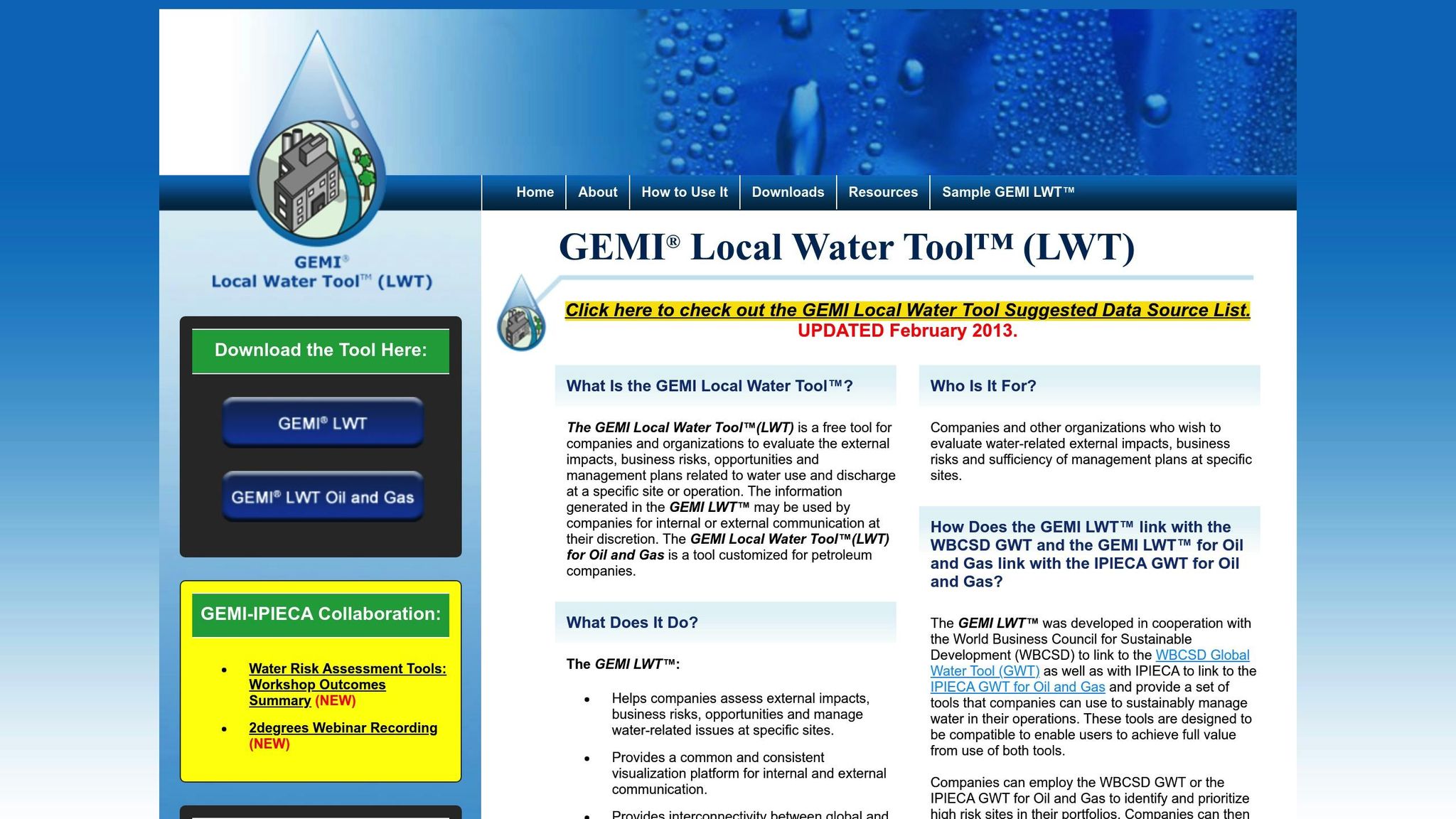
Das kostenfreie GEMI Local Water Tool (LWT) ist speziell darauf ausgelegt, standortspezifische Auswirkungen und Risiken der Wassernutzung und -ableitung zu bewerten . Es kombiniert Daten zu den Wasserzu- und -abflüssen eines Unternehmens mit Informationen über das jeweilige Einzugsgebiet. So lassen sich die relativen Auswirkungen einzelner Anlagen quantifizieren. Diese detaillierten Ergebnisse bilden die Grundlage für maßgeschneiderte Managementstrategien und helfen, gezielte Maßnahmen zur Risikominderung zu entwickeln.
Das GEMI LWT lässt sich problemlos mit anderen Tools verbinden. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem WBCSD entwickelt und kann direkt mit dem WBCSD Global Water Tool sowie dem IPIECA GWT für die Öl- und Gasindustrie verknüpft werden. Dadurch entsteht ein nahtloser Übergang von einer globalen Priorisierung zu einer detaillierten lokalen Bewertung . Für die Öl- und Gasbranche gibt es zudem eine spezielle Version, die auf die Anforderungen dieser Industrie zugeschnitten ist.
Welches Tool das richtige ist, hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall und dem gewünschten Detailgrad ab. Während der Aqueduct Water Risk Atlas ideal für ein erstes Screening und die Priorisierung über große Portfolios hinweg ist, eignet sich das GEMI Local Water Tool besser für tiefgehende, standortspezifische Analysen. Die folgende Tabelle gibt euch einen schnellen Überblick über die Unterschiede:
| Kriterium | Aqueduct Water Risk Atlas | GEMI Local Water Tool |
|---|---|---|
| Anwendungsbereich | Globales Screening und Vergleich | Standortspezifische Detailanalyse |
| Datengranularität | Einzugsgebietsebene, globale Daten | Anlagenspezifische Daten kombiniert mit Einzugsgebietsdaten |
| Primärer Zweck | Risikoidentifikation und Priorisierung | Auswirkungsbewertung und Managementplanung |
| Kosten | Kostenlos | Kostenlos |
| Update-Frequenz | Alle 4–5 Jahre | Kontinuierlich verfügbar |
| Integration | Eigenständiges Tool | Verknüpfung mit dem WBCSD Global Water Tool |
Ein strategischer Ansatz könnte so aussehen: Zunächst nutzt ihr den Aqueduct Water Risk Atlas, um potenzielle Risikostandorte zu identifizieren. Anschließend kommt das GEMI Local Water Tool zum Einsatz, um diese Standorte detailliert zu analysieren. Diese Kombination liefert eine umfassende Grundlage für ein effektives Wasserrisikomanagement.
Wasserrisikobewertungen entfalten ihren Nutzen erst, wenn sie in konkrete Maßnahmen münden. Unternehmen stehen dabei vor der Aufgabe, aus umfassenden Daten praktische Handlungsschritte abzuleiten und diese in ihre bestehenden Prozesse einzubetten. Der Übergang von der Analyse zur Umsetzung erfordert einen systematischen Ansatz, der sowohl technische als auch strategische Aspekte berücksichtigt.
Der Ausgangspunkt einer erfolgreichen Wasserrisikobewertung ist die Erhebung relevanter Daten. Dabei solltet ihr sowohl interne als auch externe Datenquellen nutzen, um Risiken präzise zu erkennen.
Besonderes Augenmerk liegt auf sogenannten Hotspots – Standorten oder Prozessen, bei denen eine intensive interne Wassernutzung auf externe Risikofaktoren wie Wasserknappheit oder regulatorische Unsicherheiten trifft. Diese Hotspots verlangen eine priorisierte Behandlung und gezielte Analysen.
Ein hilfreiches Werkzeug ist die Risikomatrix, die Standorte nach der Wahrscheinlichkeit und den Auswirkungen potenzieller Wasserrisiken kategorisiert. Produktionsstätten in wasserarmen Regionen mit hohem Wasserverbrauch landen in der Regel in der höchsten Risikokategorie. Diese Priorisierung ermöglicht eine effiziente Verteilung der Ressourcen auf Maßnahmen zur Risikominderung. So entsteht eine solide Grundlage, um die Bewertung an die lokalen Gegebenheiten anzupassen.
Globale Risikobewertungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie im Kontext lokaler Besonderheiten interpretiert werden. Was auf regionaler Ebene als moderates Risiko erscheint, kann durch lokale Bedingungen erheblich verstärkt oder abgeschwächt werden. Ein entscheidender Faktor sind die regulatorischen Rahmenbedingungen – insbesondere in Deutschland, wo strikte Umweltauflagen und die bevorstehende CSRD-Berichtspflicht zusätzliche Anforderungen mit sich bringen.
Auch die lokale Wasserinfrastruktur und -qualität spielen eine wichtige Rolle. Ein Standort in einer wasserreichen Region kann dennoch riskant sein, wenn die Infrastruktur veraltet oder die Wasserqualität unzureichend ist. Umgekehrt können moderne Technologien wie effiziente Aufbereitungsanlagen Risiken in wasserarmen Gebieten deutlich verringern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Stakeholder-Engagement. Die Einbindung lokaler Gemeinden, Behörden und anderer Wassernutzer liefert wertvolle Einblicke, die in standardisierten Bewertungstools oft unberücksichtigt bleiben. Diese Perspektiven erhöhen nicht nur die Akzeptanz vor Ort, sondern sind auch entscheidend für eine realistische Einschätzung der Risiken. Solche lokalen Erkenntnisse fließen direkt in die Entwicklung passender Maßnahmen ein und helfen, die Wasserrisikomanagement-Strategie nahtlos in die übergeordnete ESG-Strategie zu integrieren.
Aus der Risikoanalyse sollten konkrete Aktionspläne abgeleitet werden, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Maßnahmen umfassen.
Kurzfristige Maßnahmen könnten etwa die Verbesserung bestehender Prozesse, die Einführung genauer Überwachungssysteme oder die Diversifikation von Wasserquellen sein. Langfristige Strategien hingegen erfordern oft größere Investitionen, beispielsweise in Wassertechnologien wie geschlossene Kreislaufsysteme, moderne Aufbereitungsverfahren oder alternative Wasserquellen. Dabei solltet ihr nicht nur die aktuellen Wasserpreise berücksichtigen, sondern auch mögliche zukünftige Preissteigerungen und regulatorische Entwicklungen.
Die entwickelten Maßnahmen sollten in die unternehmensweite Nachhaltigkeits- und ESG-Strategie integriert werden. Das erleichtert nicht nur die interne Abstimmung und Budgetierung, sondern stärkt auch die externe Kommunikation mit Investoren und anderen Stakeholdern.
Ein entscheidender Bestandteil erfolgreicher Aktionspläne ist das Monitoring und die kontinuierliche Verbesserung. Regelmäßige Überprüfungen der Fortschritte, Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen und die Integration neuer Erkenntnisse gewährleisten, dass die Wassermanagement-Strategie langfristig effektiv bleibt. Dabei sollten sowohl quantitative Kennzahlen wie der Wasserverbrauch pro Produktionseinheit als auch qualitative Aspekte wie die Zufriedenheit der Stakeholder einbezogen werden.
Wasserrisiken spielen eine zentrale Rolle in ESG-Strategien (Environmental, Social, Governance) und sind längst keine isolierten Themen mehr. Stattdessen sind sie eng mit Klimaresilienz, sozialer Verantwortung und der langfristigen Geschäftsstrategie verbunden. Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie ohne ein durchdachtes Wassermanagement nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Risiken eingehen.
Die Dringlichkeit dieses Themas wird durch alarmierende Zahlen deutlich: Über 90 % aller Naturkatastrophen weltweit hängen mit Wasser und Wetter zusammen. In den USA verzeichnete die National Oceanic and Atmospheric Administration allein im Jahr 2023 insgesamt 28 Wetter- und Klimakatastrophen mit Schäden von jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Diese Entwicklungen zeigen klar, dass Wassermanagement ein zentraler Bestandteil von Klimarisikostrategien sein muss und als Grundlage für eine fundierte ESG-Berichterstattung dient.
Die Anforderungen an die Berichterstattung über Wasserrisiken nehmen spürbar zu. Zwischen 2017 und 2022 stieg die Offenlegung von Wasserdaten durch Unternehmen um 85 %. Im Jahr 2023 meldeten 4.815 Unternehmen ihre wasserbezogenen Daten an das CDP – ein Plus von 23 %.
In Deutschland bringt die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erhebliche Veränderungen mit sich. Die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen steigt von 550 auf 15.000. Diese Unternehmen müssen nicht nur wasserbezogene Risiken identifizieren, sondern auch deren finanzielle Auswirkungen analysieren und in Szenarioanalysen einfließen lassen.
Zusätzlich verschärft die EU-Taxonomie die Anforderungen. Wassermanagement wird hier nicht nur als Umweltfaktor betrachtet, sondern als Beitrag zu mehreren Umweltzielen, darunter die Anpassung an den Klimawandel und der Schutz von Wasserressourcen. Unternehmen müssen belegen, wie ihre Aktivitäten diese Ziele unterstützen.
Ein entscheidender Trend ist der Übergang zu dynamischen Modellierungsansätzen. Statt sich auf historische Daten zu stützen, müssen Unternehmen zukunftsgerichtete Klimaprojektionen in ihre Bewertungen einbeziehen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen für Wassermanagement, Nachhaltigkeit und Finanzen.

Angesichts dieser Herausforderungen wird spezialisierte Beratung unverzichtbar. Fiegenbaum Solutions bietet genau diese Expertise und hilft Unternehmen, Wassermanagement nahtlos in ESG-Strategien zu integrieren. Johannes Fiegenbaum verbindet regulatorisches Know-how mit unternehmerischem Verständnis – eine Kombination, die besonders bei der Umsetzung der CSRD- und EU-Taxonomie-Anforderungen von Vorteil ist.
Die Leistungen umfassen die Entwicklung maßgeschneiderter Wasserrisiko-Frameworks, die sowohl regulatorischen Vorgaben entsprechen als auch praktisch umsetzbar sind. Dabei werden quantitative Bewertungsmodelle mit qualitativen Stakeholder-Analysen kombiniert, um ein umfassendes Bild der Wasserrisiken zu schaffen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verknüpfung von Wassermanagement und Dekarbonisierungsstrategien. Viele Unternehmen übersehen die Wechselwirkungen zwischen Wasser- und Energieeffizienz. Fiegenbaum Solutions hilft dabei, diese Synergien zu erkennen und in konkrete Kosteneinsparungen umzuwandeln.
Auch die Entwicklung von Impact-Modellen und Szenarioanalysen gehört zum Portfolio. Diese Modelle berücksichtigen sowohl die lokale Wasserverfügbarkeit als auch die spezifischen regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU. So erhalten Unternehmen passgenaue Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen.
Nach der Definition strategischer Rahmenbedingungen folgt die Umsetzung – und hier ist Flexibilität gefragt. Bis 2050 könnten wasserbezogene Konflikte unter höheren Emissionsszenarien um etwa 40 % zunehmen. Das zeigt, wie wichtig kontinuierliche Überwachung und Anpassung sind.
Erfolgreiche Unternehmen setzen auf regelmäßige Überprüfungszyklen, die sowohl quantitative Daten als auch qualitative Entwicklungen einbeziehen. Moderne Überwachungssysteme kombinieren interne Verbrauchsdaten mit externen Faktoren wie Wasserverfügbarkeit, neuen Regulierungsanforderungen und sich wandelnden Erwartungen von Stakeholdern.
Ein oft übersehener Aspekt ist der Einfluss der Verbraucherperspektive. Eine Analyse aus dem Jahr 2024 ergab, dass ein Drittel der US-Verbraucher den Kauf bestimmter Produkte eingestellt hat, weil deren Produktion zu viel Wasser verbraucht. Deutsche Unternehmen sollten ähnliche Trends frühzeitig erkennen und ihre Strategien entsprechend anpassen.
Darüber hinaus müssen soziale Risiken berücksichtigt werden. Wasserstress, etwa durch Dürren, kann die Wahrscheinlichkeit sozialer Konflikte mehr als verdreifachen. Unternehmen in wasserarmen Regionen sollten diese Risiken in ihre Bewertungen einfließen lassen und präventive Maßnahmen entwickeln.
Technologie spielt dabei eine Schlüsselrolle. Digitale Plattformen und KI-gestützte Analysen ermöglichen es, Wasserrisiken in Echtzeit zu bewerten. Durch die Verknüpfung von Wetterdaten, Satelliteninformationen und lokalen Wasserstandsmeldungen lassen sich potenzielle Risiken frühzeitig erkennen. Diese Technologien in bestehende ESG-Managementsysteme zu integrieren, erlaubt es Unternehmen, proaktiv statt reaktiv zu handeln.
Die Bewertung von Wasserrisiken ist für deutsche Unternehmen nicht nur eine Pflichtübung, sondern eine strategische Chance. Angesichts verschärfter regulatorischer Anforderungen und wachsender ökologischer Herausforderungen sollten Unternehmen frühzeitig handeln, um sich einen Vorsprung gegenüber jenen zu verschaffen, die lediglich auf äußeren Druck reagieren.
Die zuvor erläuterten Ansätze und Tools bieten eine solide Grundlage für die Analyse solcher Risiken. Doch der eigentliche Mehrwert entsteht erst durch die gezielte Interpretation und Einbindung der Ergebnisse in die spezifischen Unternehmensprozesse sowie die ESG-Ziele. Eine bloße Sammlung von Daten bleibt ohne strategische Verankerung wirkungslos.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Bewertungsmodelle. Mit der Dynamik wasserbezogener Risiken und sich wandelnder regulatorischer Vorgaben ist es unerlässlich, Strategien kontinuierlich weiterzuentwickeln. Diese Maßnahmen lassen sich ideal in eine umfassende ESG-Strategie integrieren, verlangen jedoch sowohl technisches Know-how als auch ein tiefes Verständnis für die sich verändernden Rahmenbedingungen.
Fiegenbaum Solutions bietet praxisorientierte Unterstützung, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dank der Kombination aus regulatorischem Wissen und unternehmerischer Perspektive entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die nicht nur die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten, sondern auch wirtschaftlichen Nutzen schaffen. Unsere Expertise reicht von der Entwicklung moderner Wasserrisiko-Frameworks über die Integration in bestehende ESG-Strategien bis hin zur Verknüpfung mit Dekarbonisierungszielen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Wasserrisiken proaktiv zu managen, und verschaffen Sie sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Kontaktieren Sie Fiegenbaum Solutions und legen Sie den Grundstein für eine zukunftsfähige Wasserstrategie.
Um Wasserrisiken sinnvoll einzuschätzen, müsst ihr zunächst den Rahmen der Analyse klar definieren. Dazu gehören sowohl die geografischen Regionen als auch die relevanten Wasserquellen, die untersucht werden sollen. Eine Kombination aus globalen Daten und spezifischen lokalen Informationen ist dabei entscheidend, um ein möglichst genaues Bild zu erhalten.
Bei der Analyse sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:
Darüber hinaus ist es sinnvoll, den eigenen Wasserverbrauch sowie die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt zu analysieren. So könnt ihr Strategien entwickeln, die sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden. Wenn ihr die identifizierten Risiken klar priorisiert, lassen sich gezielte Maßnahmen ableiten, die euch helfen, eure langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Unternehmen können den Aqueduct Water Risk Atlas und das GEMI Local Water Tool gezielt nutzen, um ihre Wasserrisiken besser zu verstehen und anzugehen. Dabei geht es vor allem um Herausforderungen wie Wasserknappheit, Wasserqualität und regulatorische Vorgaben. Der Aqueduct Water Risk Atlas liefert eine globale Übersicht, die sich an die lokalen Gegebenheiten in Deutschland anpassen lässt, um Risiken präzise zu identifizieren.
Das GEMI Local Water Tool ergänzt diese globale Perspektive mit einer detaillierten Analyse der lokalen Wasserressourcen. So können Unternehmen spezifische Maßnahmen entwickeln, die auf die regionalen Anforderungen und Herausforderungen in Deutschland abgestimmt sind. Durch die Kombination dieser beiden Tools lassen sich Wasserrisiken gezielt minimieren. Unternehmen profitieren nicht nur durch die Erfüllung regulatorischer Vorgaben, sondern können auch ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Ziele vorantreiben.
Ein durchdachtes Wassermanagement spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, eure ESG-Strategie (Environmental, Social, Governance) auf solide Beine zu stellen. Warum? Es unterstützt Unternehmen dabei, ökologische Ziele konsequent zu verfolgen und gleichzeitig die Anforderungen der EU-Taxonomie zu erfüllen. Diese Taxonomie definiert klare Vorgaben für den nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen – von der Reduzierung des Wasserverbrauchs bis hin zum Schutz von Wasser- und Meeresökosystemen.
Ein kluges Wassermanagement ist mehr als nur ein ökologischer Beitrag. Es hilft, Risiken wie Wasserknappheit oder verschärfte regulatorische Vorgaben frühzeitig zu adressieren. Gleichzeitig könnt ihr aktiv zur Schonung wertvoller Ressourcen beitragen. Das Ergebnis? Eine gestärkte ökologische Verantwortung, die nicht nur das Image verbessert, sondern auch eure langfristige Wettbewerbsfähigkeit und regulatorische Compliance sichert.

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonWusstest du, dass Power Purchase Agreements (PPAs) nicht nur eure Energiekosten stabilisieren,...
Entdeckt das ungenutzte Potenzial freiwilliger Biodiversitätsgutschriften mit unserem umfassenden...