Von Hochwasser bis Hitzestress: Der neue Standard ISO 14091 für Klimarisikoanalysen
Wie schützt ihr euer Unternehmen vor Klimarisiken? Der Standard ISO 14091 bietet euch einen klaren...
Von Johannes Fiegenbaum am 11.08.25 07:24

Die CSRD verlangt von Unternehmen, Klimarisiken genau zu analysieren und darüber zu berichten. Dabei unterscheidet sie zwischen physischen Risiken (z. B. Überschwemmungen, Hitzewellen) und Transitionsrisiken (z. B. steigende CO₂-Preise, veränderte Kundenwünsche). Wichtig ist eine Szenarioanalyse mit zwei Temperaturszenarien: 1,5 °C und über 3 °C.
Eure Aufgabe: Risiken identifizieren, bewerten und in den ESRS-Standards dokumentieren. Dazu gehören u. a. die finanzielle Bewertung von Risiken, die Erstellung eines Risikoinventars und eine klare Dokumentation. Ab 2026 müssen alle großen Unternehmen in Deutschland diese Berichte vorlegen. Kleine und mittlere Unternehmen folgen ab 2028.
Kernpunkte:
Dieser Leitfaden hilft euch, die Anforderungen systematisch zu erfüllen, Risiken zu priorisieren und die Ergebnisse effektiv in eure Berichterstattung einzubinden.
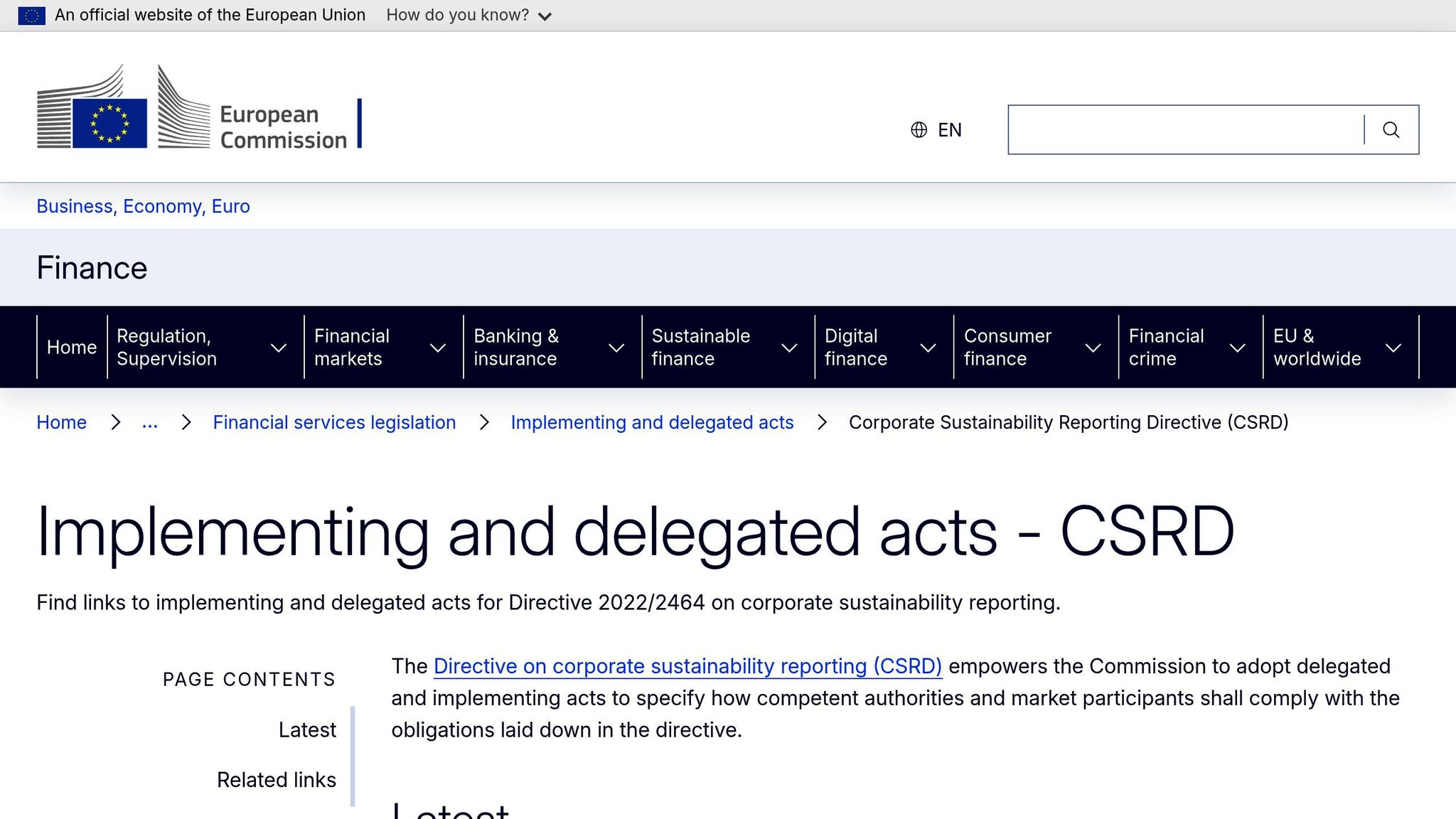
Die CSRD erweitert in Deutschland den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen im Vergleich zur bisherigen NFRD erheblich. Bereits seit 2024 müssen große, kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden berichten. Ab 2025 sind dann alle großen Unternehmen verpflichtet, einen Bericht vorzulegen, sofern sie mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen: 250 Mitarbeitende, 40 Mio. € Nettoumsatz oder 20 Mio. € Bilanzsumme. Die ersten Berichte nach CSRD-Standards müssen diese Unternehmen im Jahr 2026 für das Geschäftsjahr 2025 einreichen.
Kleine und mittlere kapitalmarktorientierte Unternehmen (KMU) werden ab dem 1. Januar 2026 ebenfalls berichtspflichtig, wobei sie die Möglichkeit haben, die Berichterstattung bis 2028 auszusetzen. Auch Drittlandunternehmen, die in der EU tätig sind, fallen ab 2028 unter die CSRD, wenn sie in der EU einen Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro erzielen und mindestens eine Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung in der EU betreiben.
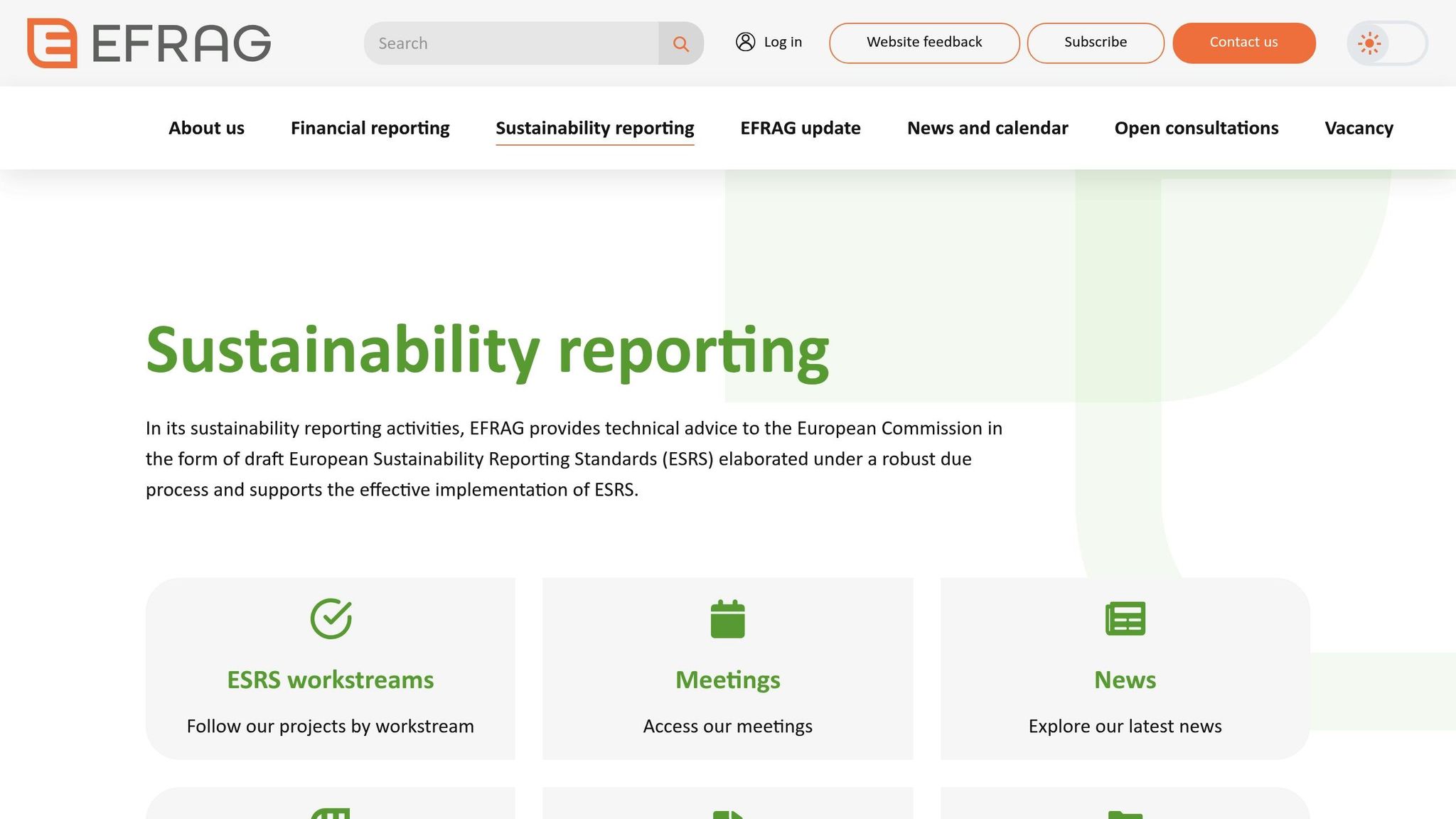
Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bilden die Grundlage für die Berichterstattung im Rahmen der CSRD. Für die Analyse von Klimarisiken sind insbesondere ESRS 2 (Allgemeine Offenlegungen) und ESRS E1 (Klimawandel) von Bedeutung.
ESRS 2 legt den Schwerpunkt auf die Wesentlichkeitsanalyse. Unternehmen müssen darlegen, wie sie Klimarisiken in ihre Geschäftsstrategie, ihr Risikomanagement und ihre Entscheidungsprozesse integrieren. Dabei spielt das Konzept der doppelten Wesentlichkeit eine zentrale Rolle: Es gilt sowohl die Auswirkungen des Unternehmens auf das Klima (Impact Materiality) als auch die finanziellen Risiken, die durch den Klimawandel auf das Unternehmen zukommen (Financial Materiality), zu berücksichtigen.
Unter ESRS E1 müssen Unternehmen Szenarien entwickeln, die mindestens ein 1,5°C-Ziel und ein Szenario mit einem stärkeren Temperaturanstieg (über 3°C) abbilden. Diese Szenarien sollen sowohl physische als auch Übergangsrisiken einbeziehen und einen Zeithorizont von mindestens 30 Jahren umfassen. Dabei ist eine quantitative Bewertung der finanziellen Auswirkungen erforderlich, soweit dies möglich ist. Falls eine Quantifizierung nicht machbar ist, müssen Unternehmen die Gründe dafür darlegen und stattdessen qualitative Beschreibungen liefern. Eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation ist in jedem Fall unerlässlich.
Um den Prüfungsanforderungen gerecht zu werden, ist eine umfassende Dokumentation aller Annahmen, Methoden und Berechnungen notwendig. Ein vollständiger Audit Trail muss sicherstellen, dass alle Schritte nachvollziehbar sind.
Die Governance-Dokumentation ist ein zentraler Bestandteil: Hierbei ist festzuhalten, welche Gremien für die Überwachung der Klimarisiken zuständig sind, wie oft diese Gremien zusammenkommen und welche Expertise sie einbringen. Auch die Rolle des Vorstands oder der Geschäftsführung bei der Genehmigung der Klimastrategie und Risikoanalyse muss klar beschrieben werden.
Das Risikoinventar sollte alle identifizierten physischen und Übergangsrisiken systematisch erfassen. Für jedes Risiko sind die genutzten Datenquellen, Annahmen und Bewertungsmethoden zu dokumentieren. Bei physischen Risiken gehören dazu beispielsweise Klimaprojektionen – in Deutschland oft die ReKIS-Daten des Deutschen Wetterdienstes – sowie Standortanalysen für gefährdete Betriebsstätten.
Für Transitionsrisiken müssen Unternehmen offenlegen, welche CO₂-Preispfade, regulatorischen Szenarien und Marktannahmen sie verwendet haben. Die Dokumentation sollte außerdem erläutern, wie sich veränderte Kundenpräferenzen, technologische Entwicklungen und Finanzierungsbedingungen auf das Geschäftsmodell auswirken könnten.
Die quantitativen Ergebnisse müssen standardisiert dargestellt werden. Das bedeutet, dass die Auswirkungen auf Umsätze, Kosten, Investitionen und Vermögenswerte für jeden Risikobereich und jedes Szenario beziffert werden. Sensitivitätsanalysen sollen verdeutlichen, wie Änderungen der Schlüsselannahmen die Ergebnisse beeinflussen könnten.
Darüber hinaus verlangt die CSRD eine Integration in die Finanzberichterstattung. Die Ergebnisse der Szenarioanalysen müssen mit den Annahmen in der Bilanzierung und Bewertung von Vermögenswerten übereinstimmen. Sollten Abweichungen auftreten, sind diese zu erklären und zu begründen.
Physische Risiken beziehen sich auf direkte Auswirkungen des Klimawandels. Diese lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: akute Risiken, wie Starkregen, Hitzewellen, Stürme oder Überschwemmungen, und chronische Risiken, die langfristig die Betriebsbedingungen verändern können, etwa durch anhaltende Temperaturanstiege oder steigenden Meeresspiegel.
Transitionsrisiken hingegen entstehen durch die Umstellung auf eine emissionsarme Wirtschaft. Dazu gehören verschiedene Bereiche:
Die Grundlage jeder fundierten Risikoanalyse ist eine strukturierte Datensammlung. Hier sind die wichtigsten Schritte:
Mit diesen Daten könnt ihr Risiken systematisch bewerten und priorisieren.
Ein strukturierter Vergleichsrahmen hilft, verschiedene Risikotypen zu bewerten und nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit sowie ihrem potenziellen Schadensausmaß zu ordnen. Die folgende Tabelle gibt euch einen Überblick:
| Risikotyp | Zeithorizont | Hauptmetriken | Primäre Datenquellen | Bewertungsansatz |
|---|---|---|---|---|
| Akute physische Risiken | Kurzfristig | Schadenshöhe, Ausfallzeiten | DWD, regionale Klimadaten, Versicherungsdaten | Wahrscheinlichkeit |
| Chronische physische Risiken | Langfristig | Kostensteigerungen, Produktivitätsverluste | Klimaprojektionen, Standortanalysen | Szenarioanalyse |
| Politische Transitionsrisiken | Mittelfristig | CO₂-Kosten, Compliance-Kosten | Gesetzestexte, Policy-Analysen | Regulierungsanalyse |
| Technologische Transitionsrisiken | Mittelfristig | Investitionsbedarf, Marktänderungen | Technologie-Roadmaps, Patentanalysen | Technologiebewertung |
| Markt-Transitionsrisiken | Variabel | Umsatzveränderungen, Margen | Marktforschung, Kundenbefragungen | Marktanalyse |
Zur Priorisierung empfiehlt sich eine Risikomatrix, die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß gegenüberstellt. Risiken, die in beiden Dimensionen hohe Werte aufweisen, sollten besonders detailliert untersucht werden.
Die Wahl passender Szenarien ist ein zentraler Schritt: Nachdem das Risikoinventar erstellt wurde, werden mögliche zukünftige Entwicklungen modelliert, die sowohl wissenschaftlichen als auch regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Im Folgenden beleuchten wir Szenarien für physische sowie Transitionsrisiken.
Für die Modellierung physischer Risiken greifen viele Unternehmen auf die Representative Concentration Pathways (RCP) des IPCC zurück. Ein mögliches Szenario könnte ambitionierte Emissionsreduktionen und moderate Klimaänderungen berücksichtigen. Ein anderes Szenario setzt auf moderate Klimaschutzmaßnahmen, die zwar spürbare, aber noch kontrollierbare Auswirkungen auf das Klimasystem haben. Schließlich gibt es Modelle, die von einem Szenario ohne wesentliche Klimaschutzmaßnahmen ausgehen – mit erheblichen Klimaerwärmungen als Folge.
Um standortspezifische Herausforderungen besser zu erfassen, können auch regionale Projektionen, wie die des Deutschen Wetterdienstes (DWD), herangezogen werden.
Transitionsrisiken hängen stark von politischen Entscheidungen und Marktdynamiken ab. Ein Szenario könnte davon ausgehen, dass Klimaziele planmäßig umgesetzt werden und Unternehmen ausreichend Zeit für Anpassungen erhalten. Ein alternatives Szenario könnte zunächst moderate Maßnahmen vorsehen, gefolgt von verschärften regulatorischen Eingriffen, die kurzfristig intensivere Anpassungen erfordern. Ein weiteres Modell kombiniert unzureichende Klimapolitik mit steigenden physischen Risiken, was eine exponentielle Zunahme der Transitionsrisiken zur Folge haben könnte.
Branchenspezifische Entwicklungen und regulatorische Meilensteine – etwa in der Automobil- oder Energiewirtschaft – sollten in der Szenarioanalyse ebenfalls berücksichtigt werden, um realistische und praxisnahe Modelle zu entwickeln.
Auf Basis der erfassten Risikodaten ist eine präzise Dokumentation der Modellierungsannahmen unerlässlich. Alle Annahmen und Methoden sollten in einer übersichtlichen Matrix festgehalten werden.
Für physische Risiken empfiehlt es sich, die verwendeten Klimamodelle, deren räumliche Auflösung und den betrachteten Zeithorizont zu dokumentieren. Wenn regionale Modelle, wie die des Deutschen Wetterdienstes, genutzt werden, sind die genaue Modellversion und relevante Parameter anzugeben.
Bei Transitionsrisiken ist es wichtig, politische und wirtschaftliche Annahmen – etwa zu CO₂-Preisen – klar zu begründen. Sensitivitätsanalysen, bei denen zentrale Parameter variiert und deren Auswirkungen dokumentiert werden, sind ebenfalls ein wertvolles Werkzeug.
Darüber hinaus sollten alle zugrunde liegenden Quellen wissenschaftlichen Standards entsprechen und in der Dokumentation eindeutig benannt werden. Eine Änderungshistorie, die alle Anpassungen der Annahmen und Methoden nachvollziehbar macht, sorgt für Transparenz. Abschließend lohnt sich ein Vergleich der Ergebnisse mit branchenüblichen Benchmarks, um mögliche Abweichungen zu erkennen und zu erklären. So wird die Analyse nicht nur umfassender, sondern auch belastbarer.
Um Risiken präzise in eure CSRD-Berichterstattung zu integrieren, ist es entscheidend, die finanziellen Auswirkungen nach der Festlegung von Szenarien und Annahmen zu quantifizieren. Dabei analysiert ihr, wie Klimarisiken sich auf Finanzlage, Ergebnis und Cashflow auswirken. Im Folgenden zeigen wir, wie physische und Transitionsrisiken finanziell bewertet werden können.
Physische Risiken lassen sich durch eine Analyse von Risikoexposition, Gefährdung und Verwundbarkeit quantifizieren. Bei akuten Risiken wie Überschwemmungen identifiziert ihr zunächst gefährdete Vermögenswerte und deren Wiederbeschaffungswerte. Anschließend schätzt ihr die Schadenswahrscheinlichkeit anhand historischer Daten und Klimaprojektionen. Ein Beispiel: Ein Produktionsstandort mit einem Anlagenwert von 50 Mio. € in einem Überschwemmungsgebiet und einer jährlichen Überschwemmungswahrscheinlichkeit von 2 % könnte zu einem erwarteten jährlichen Schaden führen, wenn ein Totalschaden angenommen wird.
Chronische Risiken, wie steigende Temperaturen, erfordern eine andere Herangehensweise. Hier könnt ihr beispielsweise höhere Kühlkosten prognostizieren. Auch Wasserstress wird relevant, indem ihr die regionale Wasserverfügbarkeit untersucht – in betroffenen Gebieten sind deutliche Preissteigerungen möglich.
Nach der Bewertung der physischen Risiken folgt die Analyse der Transitionsrisiken. Diese entstehen durch politische, rechtliche, technologische und marktbedingte Veränderungen im Zuge der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft. Hierbei können Szenarioanalysen, wie die NGFS-Klimaszenarien, als Grundlage dienen.
Ein Ansatz ist die Berechnung zusätzlicher CO₂-Kosten. Multipliziert dazu eure Scope-1- und Scope-2-Emissionen mit den prognostizierten Kohlenstoffpreisen. Ein Unternehmen mit 100.000 Tonnen CO₂-Äquivalent und einem erwarteten CO₂-Preis von 100 €/Tonne müsste mit zusätzlichen Kosten von 10 Mio. € rechnen. Auch indirekte Effekte, wie weitergereichte Kosten von Zulieferern, sollten berücksichtigt werden.
Regulatorische Risiken analysiert ihr durch die Bewertung bevorstehender Gesetzesänderungen. Die EU-Taxonomie kann zum Beispiel erhebliche Investitionen erfordern. Für Retrofitting-Maßnahmen an Gebäuden liegen die Kosten typischerweise zwischen 200 und 500 €/m². Bei einer Bürofläche von 50.000 m² müsst ihr entsprechend hohe Investitionen einplanen.
Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse betrachtet sowohl die finanziellen Auswirkungen von Risiken als auch den Einfluss des Unternehmens auf Umweltprobleme. Ihr setzt quantifizierte Klimarisiken in Relation zu relevanten Finanzkennzahlen, um signifikante Einflüsse zu erkennen. Parallel bewertet ihr, in welchem Umfang das Unternehmen Umweltprobleme mitverursacht. Besonders Scope-3-Emissionen sind hier relevant, da sie oft 70–90 % der gesamten Emissionen ausmachen.
Eine Wesentlichkeitsmatrix hilft dabei, finanzielle und ökologische Auswirkungen gegenüberzustellen. Risiken, die in beiden Dimensionen hohe Werte aufweisen, sollten priorisiert und detailliert offengelegt werden.
Ergänzend dazu sind Sensitivitätsanalysen sinnvoll. Diese zeigen, wie sich veränderte Annahmen – etwa ein stark steigender CO₂-Preis – auf die Gesamtkosten auswirken. Damit überprüft ihr die Belastbarkeit eurer Risikobewertungen und könnt Anpassungsbedarfe im Risikomanagement identifizieren.
Wichtig ist, eure Schwellenwerte und Bewertungsentscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren. Externe Konsultationen können zusätzliche Perspektiven liefern und die Glaubwürdigkeit eurer Analyse stärken.
Nachdem ihr die finanziellen Auswirkungen ermittelt habt, geht es nun darum, diese Ergebnisse in den finalen CSRD-Bericht zu integrieren. Eine systematische Dokumentation und die Einhaltung der Formatvorgaben gewährleisten dabei die Prüfungskonformität.
Die erarbeiteten Ergebnisse werden in ESRS 2 (Allgemeine Angaben) und ESRS E1 (Klimawandel) eingetragen. In ESRS 2 beschreibt ihr unter GOV-3 die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane bei der Überwachung von Klimarisiken. Führt dabei aus, wie häufig der Vorstand dieses Thema behandelt und welche spezifische Expertise vorhanden ist.
Unter SBM-3 (Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen) listet ihr die identifizierten physischen und Transitionsrisiken auf. Gebt für jedes Risiko die Zeithorizonte an (kurzfristig: bis 5 Jahre, mittelfristig: 5–15 Jahre, langfristig: über 15 Jahre), ebenso die betroffenen Geschäftsbereiche und die geografischen Regionen. Die berechneten finanziellen Auswirkungen ordnet ihr den entsprechenden Kategorien zu, z. B.: „Umsatzrückgang durch extreme Wetterereignisse: 2.500.000,00 € jährlich bei einem 2°C-Szenario“.
In ESRS E1 bearbeitet ihr die Angaben zu den Punkten E1-1 bis E1-9. Unter E1-3 definiert ihr konkrete Maßnahmen zur Risikominderung, während ihr unter E1-4 die verwendeten Klimaszenarien dokumentiert, etwa „RCP4.5 für physische Risiken“ oder „NGFS Net Zero 2050 für Transitionsrisiken“. Die Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen tragt ihr unter E1-6 ein und erläutert dabei die Datenqualität sowie die angewandten Berechnungsmethoden.
Alle Angaben müssen in einem klar nachvollziehbaren Prüfpfad dokumentiert werden. Dazu gehören detaillierte Arbeitsblätter, in denen ihr Quellen, Berechnungen und Annahmen festhaltet, sowie durchgeführte Plausibilitätsprüfungen.
Die Herkunft der Daten muss eindeutig sein: Interne Daten – wie Energieverbrauch oder Anlagenstandorte – verseht ihr mit Zeitstempeln und Verantwortlichkeiten. Externe Quellen, etwa Klimaprojektionen des Deutschen Wetterdienstes oder CO₂-Preise der European Energy Exchange, benötigen vollständige Referenzen inklusive Abrufdatum.
Falls ihr Klimamodelle oder Software-Tools verwendet, dokumentiert ihr deren Version, Konfiguration und die eingesetzten Parameter. Die Dokumentation sollte so detailliert sein, dass ein externer Prüfer die Berechnungen vollständig nachvollziehen und reproduzieren kann.
Vergleicht eure Ergebnisse mit Branchenbenchmarks oder wissenschaftlichen Studien. Sollten Abweichungen auftreten, müsst ihr diese begründen – beispielsweise durch Besonderheiten eures Geschäftsmodells oder regionale Unterschiede.
Haltet euch an deutsche Formatstandards: Währungsangaben erfolgen in Euro mit deutscher Formatierung („1.250.000,50 €“), Datumsangaben nutzt ihr im Format TT.MM.JJJJ („31.12.2024“), Temperaturen gebt ihr in Celsius an, Flächen in Quadratmetern oder Hektar, Entfernungen in Kilometern und Gewichte in Kilogramm oder Tonnen.
Verwendet Komma als Dezimaltrennzeichen und Punkte als Tausendertrennzeichen. Ein Beispiel: „1.500,0 t CO₂“ für eine CO₂-Menge von eintausendfünfhundert Tonnen. Auch bei Prozentangaben nutzt ihr das Komma: „12,5 %“. Negative Werte kennzeichnet ihr durch ein Minuszeichen vor der Zahl: „-2.500.000,00 €“.
Erstellt ein zweisprachiges Glossar für Fachbegriffe, da internationale Investoren oft englische Begriffe erwarten. Begriffe wie „Scope-1-Emissionen“ oder „Physical Risk“ sollten sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erklärt werden.
Die Berichtsstruktur orientiert sich an der Reihenfolge der ESRS-Abschnitte und verwendet deutsche Überschriften. So wird „Material impacts, risks and opportunities“ zu „Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen“. Achtet darauf, dass Querverweise zwischen den Abschnitten korrekt funktionieren und Seitenzahlen stimmen.
Bei Grafiken und Tabellen verwendet ihr deutsche Beschriftungen. Achsenbezeichnungen in Diagrammen sollten auf Deutsch sein, z. B. „Jahr“ statt „Year“ oder „Millionen Euro“ statt „Million EUR“. Auch Tabellenüberschriften folgen der deutschen Rechtschreibung mit entsprechender Groß- und Kleinschreibung.
Mit diesen Schritten ist euer CSRD-Bericht vollständig und bereit für die Prüfung. Im nächsten Abschnitt geht es darum, wie ihr eure Strategie weiterentwickeln und optimieren könnt.
Der vollständige CSRD-Bericht ist kein Endpunkt, sondern vielmehr der Startpunkt eines laufenden Prozesses. Die Szenarioanalyse muss regelmäßig aktualisiert werden, um mit den dynamischen Klimabedingungen und neuen regulatorischen Anforderungen Schritt zu halten. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung verbindet eure bisherigen Erkenntnisse direkt mit den kommenden Herausforderungen der CSRD-Berichterstattung.
Ein wichtiger Schritt: Etabliert einen jährlichen Überprüfungszyklus für eure Risikoanalyse. Da sich die Klimawissenschaft rasant weiterentwickelt, können neue Erkenntnisse eure bisherigen Annahmen beeinflussen. Plant, eure Szenarien spätestens bis Oktober jedes Jahres zu aktualisieren, sodass ausreichend Zeit bleibt, die Berichte bis zum 30. April des Folgejahres fertigzustellen.
Baut internes Fachwissen auf, um langfristig effizienter zu arbeiten. Externe Berater können zwar beim Einstieg unterstützen, doch mit eigener Expertise seid ihr flexibler. Zwei eurer Mitarbeitenden sollten in den verwendeten Methoden und Tools geschult werden, um die Kontinuität sicherzustellen. Dieses interne Wissen erleichtert es euch, klimabezogene Risiken direkt in eure Geschäftsstrategie einzubinden.
Setzt die gewonnenen Erkenntnisse gezielt in Entscheidungen um. Die identifizierten Risiken sollten nicht nur dokumentiert, sondern aktiv berücksichtigt werden – sei es bei Standortplanungen, der Auswahl von Lieferanten oder der Entwicklung neuer Produkte. Unternehmen, die Klimarisiken in ihre strategische Planung integrieren, sind besser auf kommende Herausforderungen vorbereitet.
Bleibt auf künftige Änderungen der CSRD vorbereitet. Die Standards werden sich weiterentwickeln, und zusätzliche Berichtspflichten könnten folgen. Dokumentiert deshalb eure Prozesse detailliert, um euch schnell anpassen zu können.
Neben der technischen Umsetzung ist eines entscheidend: Kommuniziert eure Ergebnisse transparent. Stakeholder erwarten fundierte Informationen zu Klimarisiken. Ein klar strukturierter und gut durchgeführter Szenarioanalyseprozess kann euch nicht nur Vertrauen sichern, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend nachhaltig orientierten Geschäftswelt verschaffen.
Um eine Szenarioanalyse im Einklang mit der CSRD durchzuführen, solltet ihr zunächst den Geltungsbereich eurer Berichterstattung klar definieren und eine Materialitätsbewertung durchführen. Dabei geht es darum, die wesentlichen physischen und Übergangsrisiken zu identifizieren, die für euer Unternehmen relevant sind.
Im nächsten Schritt folgt die Risiko- und Szenarienanalyse, bei der ihr mögliche zukünftige Entwicklungen sowie deren potenzielle Auswirkungen auf euer Geschäft bewertet. Hierbei ist es wichtig, auf wissenschaftlich fundierte Methoden und bewährte Ansätze zurückzugreifen, um Szenarien zu entwickeln, die sowohl realistisch als auch belastbar sind.
Diese Herangehensweise hilft nicht nur dabei, die Vorgaben der CSRD zu erfüllen, sondern trägt auch dazu bei, Nachhaltigkeitsaspekte strategisch in eure Unternehmensplanung zu integrieren.
Physische Risiken umfassen die direkten Folgen des Klimawandels, wie etwa extreme Wetterereignisse, steigende Meeresspiegel oder höhere Temperaturen. Solche Entwicklungen können erhebliche Schäden an Infrastruktur, Vermögenswerten oder Lieferketten verursachen – und damit die Betriebsfähigkeit von Unternehmen empfindlich stören.
Transitionsrisiken hingegen ergeben sich aus dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Dazu gehören neue gesetzliche Vorgaben, technologische Entwicklungen oder veränderte Marktanforderungen, die bestehende Geschäftsmodelle unter Druck setzen können. Unternehmen müssen sich auf diese Veränderungen einstellen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.
Der Schlüssel für Unternehmen liegt darin, physische Risiken frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Folgen des Klimawandels standzuhalten. Gleichzeitig ist es wichtig, Transitionsrisiken strategisch anzugehen, um sich an regulatorische und marktseitige Veränderungen anzupassen – und so die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Die doppelte Wesentlichkeit spielt eine Schlüsselrolle in der CSRD-Berichterstattung. Dabei geht es darum, zwei Perspektiven zu berücksichtigen: Zum einen, wie sich die Aktivitäten eures Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft auswirken (die sogenannte ‚Inside-Out‘-Perspektive). Zum anderen, wie externe Nachhaltigkeitsfaktoren eure finanzielle Situation beeinflussen können (‚Outside-In‘-Perspektive).
Damit ihr die doppelte Wesentlichkeit erfolgreich umsetzt, sind folgende Schritte hilfreich:
Wenn die doppelte Wesentlichkeit klar in eure Berichterstattung eingebunden wird, schafft das nicht nur Transparenz, sondern stärkt auch das Vertrauen in eure Nachhaltigkeitsstrategie.

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonWie schützt ihr euer Unternehmen vor Klimarisiken? Der Standard ISO 14091 bietet euch einen klaren...
Ab 2026 gelten in der EU neue Standards für Klimarisikoanalysen: ISO 14091 und die Corporate...
In einer Zeit, in der Wasserknappheit und Klimawandel Schlagzeilen machen, können sich Unternehmen...