14 min Lesezeit
Schnellcheck: Wie nachhaltig ist Ihr Unternehmen? Self-Assessment für Einsteiger
Von Johannes Fiegenbaum am 31.07.25 05:08

Wie nachhaltig ist euer Unternehmen? Mit einem klaren Blick auf die ESG-Bereiche – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – könnt ihr eure Nachhaltigkeitsleistung bewerten und gezielt verbessern. Die EU verschärft die Berichtspflichten: Ab 2025 betrifft die CSRD bis zu 50.000 Unternehmen. Eine frühzeitige Selbstbewertung ist daher entscheidend, um rechtliche Anforderungen zu erfüllen und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Wichtige Schritte:
- Umwelt: CO₂-Fußabdruck messen, Ressourcennutzung optimieren, Kreislaufwirtschaft fördern.
- Soziales: Mitarbeiterzufriedenheit steigern, Vielfalt fördern, Lieferketten prüfen.
- Governance: Transparente Berichte, ESG-Ziele in Vergütung integrieren, Anti-Korruptionsmaßnahmen umsetzen.
Mit einer strukturierten Checkliste und klaren Zielen könnt ihr eure ESG-Strategie wirksam gestalten. Nutzt bewährte Standards wie GRI oder den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, um Fortschritte messbar zu machen und Vertrauen aufzubauen.
ESG und CSRD erfolgreich anwenden: 5 Schritte zur nachhaltigen Unternehmensstrategie
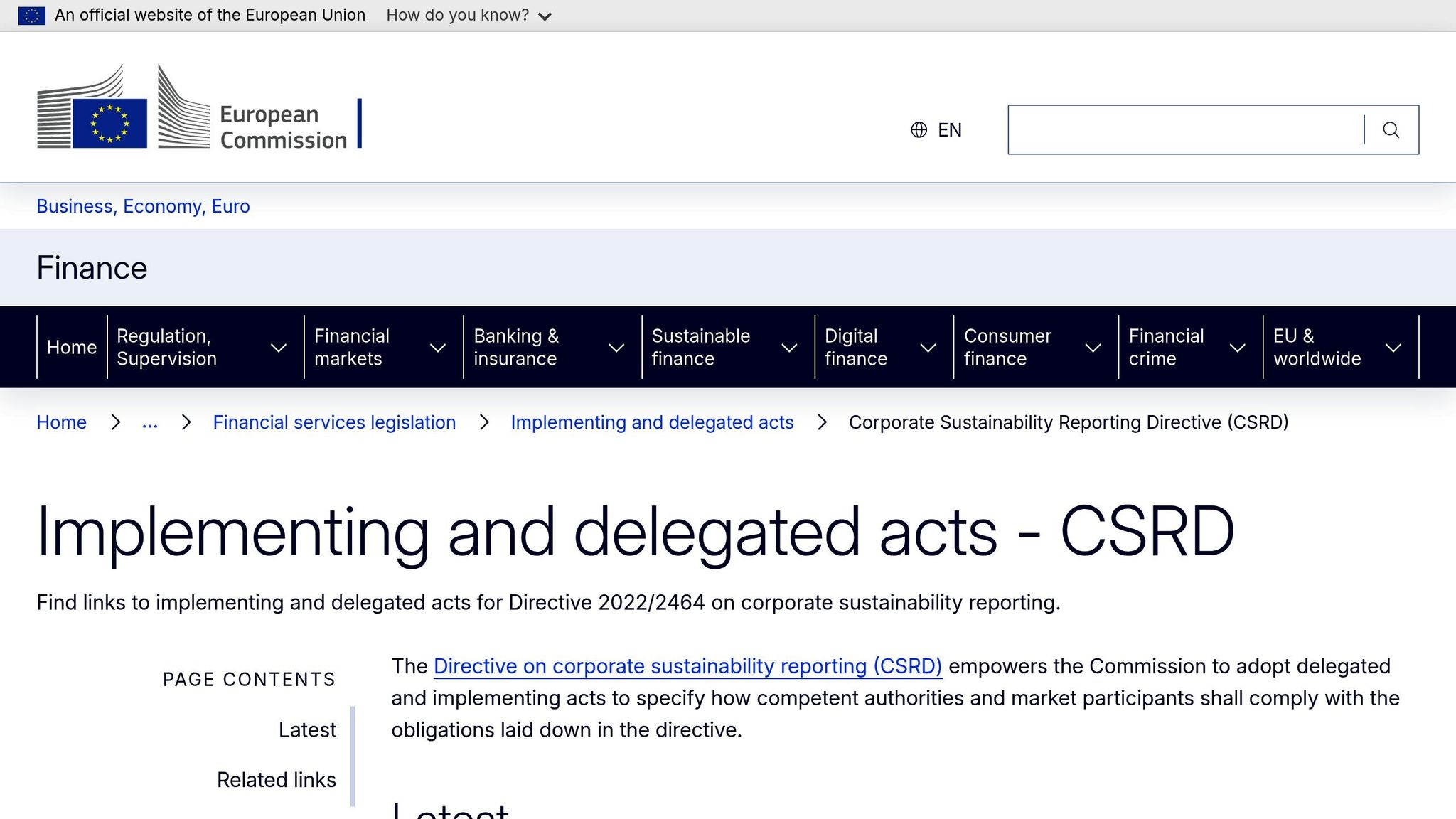
Zentrale ESG-Bereiche zur Bewertung
Um eine fundierte ESG-Bewertung durchzuführen, ist es wichtig, die drei Kernbereiche – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – systematisch zu analysieren.
Umweltaspekte (Environmental)
Im Bereich Umwelt geht es darum, wie sich euer Unternehmen auf die Umwelt auswirkt. Ein zentraler Punkt ist die Ressourceneffizienz: Wie effizient werden Energie, Wasser und Rohstoffe genutzt? In Deutschland gibt es hier bereits deutliche Fortschritte: Über 70 % der Unternehmen kennen ihren CO₂-Fußabdruck, und rund 54 % haben konkrete Ziele zur Reduzierung ihrer Emissionen formuliert.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die Treibhausgasemissionen, die in Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie) und Scope 3 (alle weiteren indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette) unterteilt werden. Ein Beispiel für ambitionierte Maßnahmen liefert Lidl: Das Unternehmen hat seine Scope-2-Emissionen um 97,4 % gesenkt, indem es vollständig auf grünen Strom umgestiegen ist.
Auch die Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft spielen eine immer größere Rolle. Hier geht es darum, Abfälle zu vermeiden, wiederzuverwenden und zu recyceln. Mercedes-Benz zeigt, wie ambitionierte Ziele aussehen können: 2022 erreichte das Unternehmen CO₂-Neutralität an seinen Fahrzeugproduktionsstandorten und plant, die Emissionen bis 2030 um 80 % zu reduzieren.
Ein oft übersehener, aber entscheidender Punkt ist die Klimaanpassung. Wie bereitet ihr euch auf klimabedingte Risiken vor? Die EU-Taxonomie-Verordnung bietet hilfreiche Orientierung, um zu bestimmen, ob wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können.
Nach der Bewertung eurer Umweltleistung könnt ihr euch den sozialen Auswirkungen eures Handelns zuwenden.
Soziale Verantwortung (Social)
Der soziale Bereich befasst sich mit den Auswirkungen eures Unternehmens auf Menschen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation. Mitarbeiterzufriedenheit ist hier ein zentraler Indikator. Regelmäßige Umfragen und Feedbackmechanismen helfen, das Wohlbefinden der Belegschaft zu messen und gezielt zu verbessern.
Vielfalt und Inklusion sind ebenfalls wichtige Aspekte. Unternehmen sollten Diversitätskennzahlen wie die Verteilung von Geschlechtern und ethnischen Gruppen erfassen, um Chancengleichheit und ein inklusives Arbeitsumfeld zu fördern. Interessanterweise zeigen Studien, dass Unternehmen mit vielfältigen Vorständen oft bessere finanzielle Ergebnisse erzielen und kreativer agieren.
Ein weiterer messbarer Bereich sind philanthropische Beiträge. Dabei geht es nicht nur um die Höhe von Spenden oder ehrenamtlichen Stunden, sondern auch um den tatsächlichen Einfluss auf Bereiche wie Bildung, Gesundheitsversorgung oder die Entwicklung lokaler Gemeinschaften.
Auch die Nachhaltigkeit der Lieferanten rückt zunehmend in den Fokus. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Lieferketten verantwortungsvoll gestaltet sind, indem sie die Umwelt- und Sozialstandards ihrer Partner bewerten.
Unternehmensführung und Ethik (Governance)
Neben Umwelt und Soziales ist auch die Unternehmensführung ein entscheidender Bestandteil einer umfassenden ESG-Bewertung. Gute Governance zeichnet sich durch Transparenz, Verantwortlichkeit und eine langfristige Wertschöpfung aus. Die Zusammensetzung des Vorstands ist dabei ein zentraler Punkt: Unternehmen sollten über die Diversität in ihren Führungsgremien berichten – sei es hinsichtlich Geschlecht, Herkunft oder Erfahrung.
Ein spannender Trend ist die Verknüpfung der Vergütung von Führungskräften mit ESG-Zielen. So hat Unilever beispielsweise einen Teil der Boni seiner Führungskräfte an den Fortschritt bei Nachhaltigkeitszielen gekoppelt. Dadurch wird sichergestellt, dass ESG nicht nur eine Priorität auf dem Papier bleibt, sondern auch aktiv vorangetrieben wird.
Anti-Korruptionsmaßnahmen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sind essenziell, um das Vertrauen der Stakeholder zu gewinnen. Hierbei sollten Unternehmen transparent darlegen, welche Prozesse sie implementiert haben, um Betrug zu verhindern und ethisches Verhalten auf allen Ebenen zu fördern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Stakeholder-Engagement. Regelmäßige Wesentlichkeitsanalysen helfen dabei, die Themen zu identifizieren, die sowohl für die Stakeholder als auch für die Unternehmensleistung von Bedeutung sind. Dennoch zeigt eine Umfrage, dass zwar 88 % der Führungskräfte die Bedeutung von CSR- und ESG-Berichterstattung betonen, aber nur 37 % sich mit ihrem aktuellen Messansatz sicher fühlen.
ESG-Checkliste für Einsteiger
Eine strukturierte Checkliste kann euch dabei helfen, die Nachhaltigkeitsleistung eures Unternehmens gezielt zu bewerten. Ein guter Ausgangspunkt sind bewährte Standards: So nutzen 73 % der 250 größten Unternehmen weltweit den GRI-Standard zur Überwachung ihrer Nachhaltigkeitsziele.
Warum ist das wichtig? Die Messung von Nachhaltigkeitskennzahlen bietet euch die Möglichkeit, Fortschritte zu dokumentieren, Maßnahmen zu bewerten und das Vertrauen eurer Stakeholder zu stärken. Im Folgenden findet ihr konkrete Ansätze – von Umweltkennzahlen bis hin zu Governance-Indikatoren –, die ihr direkt auf eure Unternehmensrealität anwenden könnt.
Umwelt-Checkliste
Um den ökologischen Fußabdruck eures Unternehmens zu erfassen, ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen essenziell. Analysiert Stromrechnungen, Abfallprotokolle und Transportdaten.
Energieverbrauch und Emissionen:
Ermittelt den Gesamtenergieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) und berechnet die Energieintensität pro Produktionseinheit. Dokumentiert den Anteil erneuerbarer Energien in Prozent und messt euren CO₂-Fußabdruck in Tonnen CO₂-Äquivalent.
Siemens konnte seine Emissionen um 46 % senken, nachdem über 650 Millionen Euro in CO₂-Reduktionsmaßnahmen investiert wurden.
Wasser- und Abfallmanagement:
Erfasst den Wasserverbrauch in Kubikmetern pro Produktionseinheit und den Anteil des behandelten Abwassers. Dokumentiert die Abfallmengen (in Kilogramm pro Produktionseinheit) sowie Recycling- und Kompostierungsquoten. Achtet zudem darauf, den Anteil recycelter Materialien in euren Produkten zu erfassen.
Lieferkette und Materialien:
Bewertet die Material-Input-Effizienz (MIPS) und identifiziert kritische Lieferanten und Risikokategorien. Stellt sicher, dass eure Lieferanten Umweltstandards einhalten.
Sobald ihr eure Umweltkennzahlen vollständig erfasst habt, könnt ihr euch der sozialen Dimension widmen.
Checkliste für soziale Verantwortung
Die soziale Verantwortung eines Unternehmens erfordert enge Zusammenarbeit mit der Personalabteilung und regelmäßige Befragungen eurer Stakeholder.
Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden aktiv in CSR-Aktivitäten einbinden, berichten von einem Produktivitätsanstieg von 20 %.
Mitarbeiterwohlbefinden:
Führt regelmäßige Zufriedenheitsumfragen durch und analysiert die Fluktuationsrate. Erfasst Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter sowie Arbeitsunfälle und krankheitsbedingte Ausfallzeiten.
Vielfalt und Inklusion:
Dokumentiert die Geschlechterverteilung in Führungspositionen und die ethnische Vielfalt im Unternehmen. Messt die Lohngleichheit zwischen verschiedenen Gruppen und führt Inklusionsumfragen durch.
Gemeinschaftsengagement:
Erfasst philanthropische Beiträge in Euro und dokumentiert die ehrenamtlichen Arbeitsstunden eurer Mitarbeitenden.
70 % der Verbraucher bevorzugen Marken, die sich für Nachhaltigkeit engagieren.
Bewertet den Einfluss eurer Initiativen auf Bereiche wie Bildung, Gesundheitsversorgung oder die Entwicklung lokaler Gemeinschaften.
Stakeholder-Feedback:
Sammelt aktiv Rückmeldungen von Mitarbeitenden, Kunden und Gemeindemitgliedern – dies ist entscheidend, um eure CSR-Strategien zu verbessern. Moderne Technologien können euch bei der Datensammlung und -analyse unterstützen.
Governance-Checkliste
Eine gute Unternehmensführung stärkt die Entscheidungsfindung, fördert ethisches Verhalten und schafft Vertrauen.
Mehr als die Hälfte der Unternehmensführer ist überzeugt, dass ESG-Faktoren zu besseren Entscheidungen beitragen.
Vorstandsstruktur und Vielfalt:
Dokumentiert die Zusammensetzung eures Vorstands in Bezug auf Geschlecht, Herkunft und Erfahrung. Entwickelt Richtlinien für Diversität und Inklusion und messt die Unabhängigkeit sowie ESG-Expertise der Vorstandsmitglieder.
Vergütung und Anreizsysteme:
Stellt sicher, dass die Vergütung der Führungskräfte an langfristige Stakeholder-Interessen gekoppelt ist. Erfasst, welcher Anteil der Vergütung auf ESG-Ziele ausgerichtet ist.
Transparenz und Compliance:
Für institutionelle Investoren ist Anti-Korruption das wichtigste ESG-Thema – noch vor Klimawandel und Aktionärsrechten.
Implementiert Anti-Korruptions-Programme, Whistleblowing-Mechanismen und Schulungen, um ethisches Verhalten zu fördern.
Stakeholder-Rechte:
Sorgt dafür, dass Aktionäre durch Engagement-Prozesse und Stimmrechte Gehör finden. Entwickelt eine ESG-Berichterstattungsstrategie und nutzt verschiedene Kanäle, um eure Ergebnisse transparent zu kommunizieren.
Bewertung der Ergebnisse und Verbesserungsplanung
Nachdem ihr eure ESG-Checkliste abgeschlossen habt, steht die systematische Auswertung eurer Ergebnisse an. ESG-Scores liefern eine messbare Grundlage, um die Leistung eures Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu bewerten. Sie helfen euch dabei, euer Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken besser zu verstehen und gezielt zu verbessern. Diese Analyse zeigt nicht nur eure Stärken und Schwächen auf, sondern legt auch den Grundstein für konkrete Verbesserungsmaßnahmen, die Investoren überzeugen, eure Reputation stärken und langfristig nachhaltiges Wachstum fördern können.
Ergebnisse gezielt zur Lückenanalyse nutzen
Die Checkliste ist ein wertvolles Werkzeug, um Schwachstellen klar zu identifizieren. Startet mit einer Risikoanalyse und bewertet, welche Maßnahmen euren ESG-Score verbessern könnten. Vergleicht dabei zentrale Indikatoren wie Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und Abfallmengen mit den Benchmarks eurer Branche. Interessanterweise verursachen Lieferketten oft mehr als 80 % der gesamten Umweltauswirkungen eines Unternehmens – ein Bereich, in dem häufig großes Optimierungspotenzial liegt.
Um Fortschritte zu erzielen, entwickelt ihr am besten einen Aktionsplan mit klaren Zielen, festen Deadlines und definierten Verantwortlichkeiten. Unternehmen wie Microsoft und Adidas zeigen, wie ambitionierte Ziele aussehen können: Microsoft strebt an, bis 2030 kohlenstoffnegativ zu werden, während Adidas bis 2024 nur noch recyceltes Polyester in seinen Produkten verwenden will. Priorisiert eure Maßnahmen nach deren Wirkung und Umsetzbarkeit und etabliert Mechanismen, um Fortschritte regelmäßig zu überwachen.
Vergleichsmatrix als Bewertungsinstrument
Eine Vergleichsmatrix ist ein hilfreiches Werkzeug, um die identifizierten Lücken systematisch zu bewerten. Sie unterstützt euch dabei, eure ESG-Leistung objektiv einzuordnen und eure Position innerhalb der Branche zu bestimmen. Führt außerdem Gespräche mit euren Stakeholdern, um deren Erwartungen in Bezug auf ESG-Themen besser zu verstehen. Schließlich wünschen sich 89 % der globalen Investoren ESG-Berichte, die auf einheitlichen Standards basieren.
Sammelt relevante ESG-Daten und vergleicht diese mit Branchenstandards, um konkrete Verbesserungspotenziale zu erkennen. Setzt dabei SMART-Ziele – also spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Vorgaben – und erstellt detaillierte Pläne mit klaren Zeitvorgaben, Budgets und Verantwortlichkeiten. Eine kontinuierliche Überwachung sowie regelmäßige Berichte über eure Fortschritte sind entscheidend, um eure ESG-Strategien an neue Vorschriften, technologische Entwicklungen und die Erwartungen der Stakeholder anzupassen.
Am Ende können solide ESG-Leistungskennzahlen nicht nur eure Glaubwürdigkeit stärken, sondern euch auch dabei helfen, Vorwürfen des Greenwashings vorzubeugen.
Tools und Unterstützung für Nachhaltigkeitsbemühungen
Eure ESG-Analyse ist der erste Schritt – doch um echte Fortschritte zu erzielen, braucht ihr die passenden Werkzeuge und Unterstützung. Mit den richtigen Frameworks, Softwarelösungen und Beratungsangeboten könnt ihr sicherstellen, dass eure Maßnahmen nicht nur oberflächlich bleiben, sondern messbare Ergebnisse liefern.
Bewährte Frameworks für ESG-Compliance
Gerade für den Einstieg bieten sich etablierte Standards wie der Global Reporting Initiative (GRI) und der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) an. Der DNK, ein freiwilliger Transparenzstandard des Rates für Nachhaltige Entwicklung, umfasst 20 Kriterien in den Bereichen Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft.
Ein weiteres wichtiges Instrument ist die EU-Taxonomie, die seit Januar 2022 für die Umweltziele Klimaschutz und Klimaanpassung gilt. Sie definiert wissenschaftlich fundiert, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten. Nachhaltigkeitsexperte Quentin Hennaux beschreibt die Zielsetzung so:
"Any company can say they are sustainable, but the EU Taxonomy intends to provide stakeholders with appropriate definitions for which activities can be considered environmentally sustainable thanks to science-based criteria."
Darüber hinaus spielen die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) eine zentrale Rolle. Sie basieren auf Frameworks wie CDP, GRI und SASB und umfassen über 140 Nachhaltigkeitsindikatoren, die Unternehmen erfassen und offenlegen müssen. Ob ihr diese Informationen im Konzernlagebericht oder in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, bleibt euch überlassen.
Diese Standards bilden die Basis für spezialisierte Softwarelösungen, wie sie etwa von Fiegenbaum Solutions angeboten werden.
Unterstützung durch Fiegenbaum Solutions

ESG-Software vereinfacht die Erfassung, Analyse und Berichterstattung eurer ESG-Daten. Sie sorgt nicht nur für präzisere Daten, sondern stellt auch die Einhaltung relevanter Standards sicher. Bei der Auswahl solcher Tools solltet ihr auf Funktionen wie automatisierte Datenerfassung, Berechnungsmodule, Framework-Integration, Analysefunktionen und Benutzerfreundlichkeit achten. Die Kosten richten sich meist nach Unternehmensgröße, Funktionsumfang und Datenvolumen und werden häufig im Abonnementmodell angeboten.
Fiegenbaum Solutions bietet darüber hinaus umfassende Beratung – von der Impact-Analyse bis hin zur Entwicklung langfristiger ESG-Strategien. Johannes Fiegenbaum bringt dabei nicht nur regulatorische Expertise, sondern auch praktische Markteinblicke und unternehmerisches Denken mit, um euch bei der Umsetzung messbarer und zukunftssicherer Maßnahmen zu unterstützen.
Das Beratungsangebot reicht von projektbasierten Lösungen, etwa für Lebenszyklusanalysen oder ESG-Roadmaps, bis hin zu Retainer-Modellen für kontinuierliche Unterstützung. Für Startups gibt es spezielle Konditionen, die auf die oft begrenzten Ressourcen in der Anfangsphase Rücksicht nehmen.
Wann ESG-Beratung besonders sinnvoll ist
Viele Unternehmen greifen auf externe ESG-Berater zurück, wenn interne Ressourcen oder das nötige Fachwissen fehlen, um die komplexen Anforderungen von ESG-Vorschriften und Reporting-Frameworks zu bewältigen. Der deutsche Markt für Nachhaltigkeitsberatung wächst stark: 2024 lag das Volumen bei 1,2 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2033 auf 2,2 Milliarden US-Dollar steigen – mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,4 %.
Besonders hilfreich wird professionelle Unterstützung, wenn es darum geht, gezielte Strategien zu entwickeln, die in konkrete, messbare Ergebnisse münden sollen. Kleine Unternehmen profitieren zudem von vereinfachten Standards: So hat EFRAG im Dezember 2024 freiwillige Berichtsstandards speziell für KMUs eingeführt, um den Einstieg zu erleichtern. Gleichzeitig zielt die EU-Omnibus-Verordnung darauf ab, Berichtspflichten um 25 % zu reduzieren, ohne die wesentlichen Elemente der Frameworks zu verändern.
Diese Entwicklungen zeigen, wie wichtig es ist, frühzeitig die richtigen Tools und Beratungsangebote auszuwählen, um von vereinfachten Prozessen und klaren Vorgaben zu profitieren. Ein strukturierter Ansatz kann entscheidend sein, um in einem sich schnell wandelnden regulatorischen Umfeld erfolgreich zu bleiben.
Fazit und nächste Schritte
Der ESG-Schnellcheck ist abgeschlossen – jetzt geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen zu überführen. Eure Analyse der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance hat aufgezeigt, wo euer Unternehmen aktuell steht und welche Felder noch Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für eure nächsten Schritte.
Ein sinnvoller nächster Schritt ist die Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse. Damit könnt ihr die Umweltwirkungen und sozialen Einflüsse eures Unternehmens systematisch erfassen und priorisieren. Dieses Vorgehen ist nicht nur für die CSRD-Berichterstattung relevant, sondern hilft euch auch, eure Ressourcen gezielt auf die wichtigsten ESG-Themen zu konzentrieren.
Richtet eure Maßnahmen an den sechs Umweltzielen der EU-Taxonomie aus: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität. Diese Ziele bieten euch einen klaren Rahmen, um eure Nachhaltigkeitsstrategie zu strukturieren.
Parallel dazu solltet ihr eure Daten systematisch erfassen und kontinuierlich überwachen. Dazu gehören relevante Klima- und Mitarbeiterkennzahlen, die regelmäßig aktualisiert und überprüft werden sollten. Unternehmen berichten im Durchschnitt über eine Ausrichtung von 10 % des Umsatzes, 16 % der Investitionsausgaben (CapEx) und 12 % der Betriebsausgaben (OpEx) an der EU-Taxonomie. Diese Benchmarks können euch dabei helfen, eure Fortschritte besser zu bewerten und einzuordnen.
Dokumentiert zudem eure Sorgfaltspflichten und Korrekturmaßnahmen sorgfältig, um den Anforderungen der OECD-Leitsätze, UN-Leitprinzipien und ILO-Kernarbeitsnormen zu entsprechen.
„Die EU-Taxonomie stellt ein wegweisendes Rahmenwerk dar, das darauf abzielt, nachhaltige Investitionen zu fördern und die ambitionierten Klimaziele der Europäischen Union im Rahmen des European Green Deal zu unterstützen“.
Dieses System könnt ihr als Leitfaden für eure langfristige Strategie nutzen.
Beginnt mit Maßnahmen, die sich schnell und ohne große Investitionen umsetzen lassen. Erstellt parallel dazu einen Fahrplan für komplexere Vorhaben, die technische Anpassungen an den Kriterien der EU-Taxonomie erfordern.
Insgesamt sind bis zu 50.000 Unternehmen von der CSRD betroffen. Nutzt Tools und Beratung, um aus eurer Selbstbewertung eine zukunftssichere und effektive Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln.
FAQs
Warum sollte mein Unternehmen frühzeitig eine ESG-Selbstbewertung durchführen?
Eine frühzeitige ESG-Selbstbewertung bietet euch die Möglichkeit, potenzielle Nachhaltigkeitsrisiken frühzeitig zu identifizieren und gezielt darauf zu reagieren. So könnt ihr nicht nur euer Risikomanagement optimieren, sondern auch eure Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen stärken und euch im Wettbewerb besser positionieren.
Mit einer proaktiven ESG-Bewertung seid ihr zudem besser auf gesetzliche Vorgaben wie die CSRD oder die EU-Taxonomie vorbereitet. Langfristig stärkt dies eure Marktposition. Unternehmen, die frühzeitig aktiv werden, gewinnen häufig an Reputation und schaffen Vertrauen bei Kunden, Investoren und Geschäftspartnern – ein klarer Vorteil in einer zunehmend nachhaltigkeitsorientierten Geschäftswelt.
Wie kann ich die Nachhaltigkeit meiner Lieferkette sicherstellen?
Um die Nachhaltigkeit eurer Lieferkette zu gewährleisten, ist es wichtig, mit einer gründlichen Risikoanalyse zu starten. So könnt ihr potenzielle Umwelt- und Sozialrisiken frühzeitig erkennen und gezielt auf Schwachstellen reagieren.
Ein Risikomanagementsystem sollte dabei nicht fehlen. Es hilft, die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards sicherzustellen – insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen des deutschen Lieferkettengesetzes. Regelmäßige Audits und eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten tragen dazu bei, Transparenz zu schaffen und kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen.
Ein weiterer entscheidender Schritt: Bindet eure Lieferanten aktiv in eure Nachhaltigkeitsstrategie ein. Schulungen und klar definierte Standards können dabei unterstützen, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. So legt ihr den Grundstein für eine Lieferkette, die auch langfristig nachhaltig bleibt.
Welche Tools und Methoden helfen dabei, die Nachhaltigkeitsleistung meines Unternehmens effektiv zu bewerten und zu verbessern?
Um die Nachhaltigkeitsleistung eures Unternehmens in Deutschland gezielt zu bewerten und weiterzuentwickeln, stehen euch verschiedene Tools und Ansätze zur Verfügung. ESG-Softwarelösungen sind dabei besonders hilfreich, da sie euch ermöglichen, Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen und die Einhaltung von Standards wie der CSRD oder der EU-Taxonomie zu gewährleisten. Solche Plattformen sind speziell für das ESG-Management konzipiert und bieten eine strukturierte Grundlage, um Nachhaltigkeitsziele effektiv zu verfolgen.
Ein weiterer nützlicher Ansatz sind Selbstbewertungstools, die euch einen schnellen Überblick über die Stärken und Schwächen eurer aktuellen Nachhaltigkeitsstrategie verschaffen. Mit diesen Tools könnt ihr gezielt Maßnahmen ableiten und eure Prozesse Schritt für Schritt an internationale Standards anpassen. So habt ihr die Möglichkeit, eure ESG-Ziele effizient umzusetzen und langfristig eine nachhaltigere Unternehmensstrategie zu etablieren.

Johannes Fiegenbaum
ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonDas könnte dich auch interessieren
Wasser- und Klimarisiken im Bericht sichtbar machen: Praxis-Guide für die CSRD-konforme Risikoberichterstattung (inkl. Beispiel)
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stellt neue, verbindliche Anforderungen an...