ESG im Venture Capital 2026: Warum die Regeln jetzt wirklich greifen
Ab 2026 gelten in der EU und Deutschland verbindliche ESG-Vorgaben für Venture-Capital-Fonds. Das...
Von Johannes Fiegenbaum am 20.08.25 06:23

Ihr wollt wissen, welche ESG-Kennzahlen im Jahr 2026 für Climate VCs entscheidend sind? Die Antwort ist klar: Ohne präzise Daten zu CO₂-Intensität, vermiedenen Emissionen und Social Impact kommt ihr nicht weit. Strengere Vorgaben wie die CSRD und die EU-Taxonomie machen ESG-Berichterstattung zur Pflicht – und bieten zugleich Chancen, den Erfolg eurer Investments messbar zu machen.
Das Wichtigste in Kürze:
Diese Kennzahlen sind nicht nur für Compliance wichtig, sondern machen eure Fonds auch attraktiver für Investoren. Wer jetzt in klare ESG-Strategien und Tools investiert, schafft Vertrauen – und sichert langfristigen Erfolg.
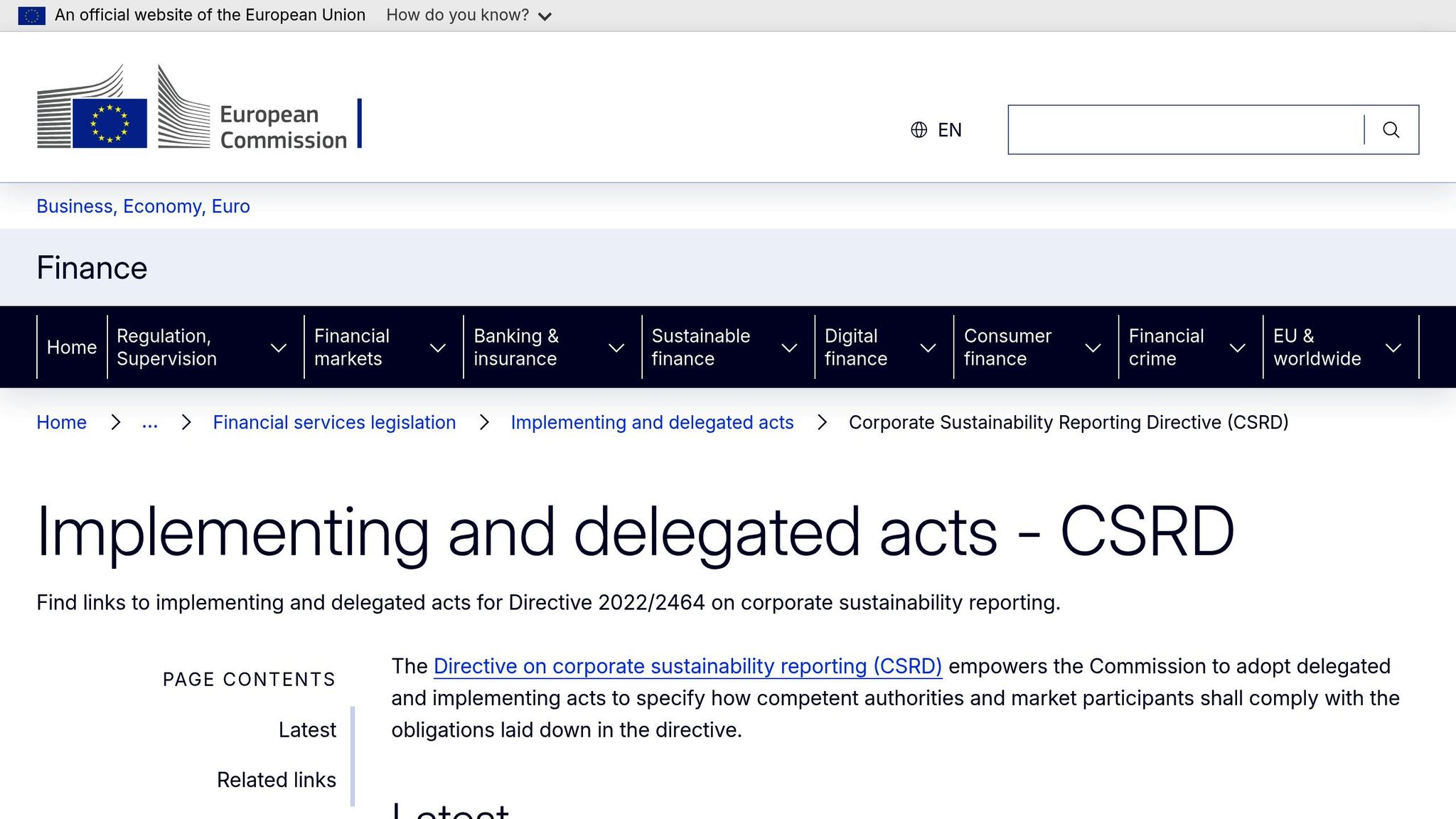
Die regulatorischen Vorgaben für Climate VCs in Deutschland basieren auf einer Mischung aus EU-weiten und nationalen Richtlinien. Dazu gehören die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die EU-Taxonomie und spezifische deutsche Gesetze. Diese Regelwerke legen fest, welche ESG-Kennzahlen erfasst und in Investmententscheidungen einbezogen werden müssen. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die zentralen Anforderungen.
Die CSRD bringt erweiterte Berichtspflichten für Unternehmen, die unter die entsprechenden Schwellenwerte fallen, mit sich. Diese müssen detaillierte ESG-Berichte gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vorlegen. Ein Kernpunkt ist die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die sowohl die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft als auch finanzielle Risiken bewertet. Für Climate VCs bedeutet das: Sie müssen Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ihrer Portfoliounternehmen erfassen und dokumentieren. Darüber hinaus sind Klimaanpassungsstrategien sowie Bewertungen physischer und transitorischer Klimarisiken erforderlich.
Die EU-Taxonomie definiert, was als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivität gilt. Für Climate VCs ist es entscheidend, dass ein erheblicher Anteil ihrer Portfoliounternehmen Aktivitäten ausübt, die mit der Taxonomie konform sind. Die technischen Bewertungskriterien verlangen dabei den Nachweis messbarer Umweltfortschritte. Zudem ist das „Do No Significant Harm“-Prinzip (DNSH) einzuhalten, was oft umfangreiche Lifecycle Assessments (LCA) und ein kontinuierliches Monitoring der ESG-Daten erfordert.
In Deutschland ergänzen nationale Vorgaben wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und Anpassungen im Handelsgesetzbuch (HGB) die EU-Regelungen. Climate VCs müssen sicherstellen, dass ihre Portfoliounternehmen menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette einhalten. Zusätzlich hat die BaFin Leitlinien für nachhaltige Investmentfonds veröffentlicht, die regelmäßige Berichterstattung und externe Prüfungen der ESG-Daten verlangen.
Ein weiterer Aspekt: Die nationale Sustainable Finance-Strategie fordert von Climate VCs, die staatliche Förderungen erhalten, den Nachweis ihres Beitrags zur Reduktion von Treibhausgasemissionen in Deutschland. Diese Vorgaben schaffen einen klaren Rahmen für strategische Investments und unterstreichen die Bedeutung präziser ESG-Kennzahlen im gesamten Entscheidungsprozess.
Im Rahmen der regulatorischen Anforderungen spielen bestimmte Kennzahlen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des tatsächlichen Impacts von Investments. Im Jahr 2026 stehen drei Kennzahlen besonders im Fokus. Werfen wir einen genaueren Blick auf die CO₂-Intensität, die als Maßstab für Klimawirkung gilt.
Die CO₂-Intensität misst die Menge an Treibhausgasemissionen in Relation zu einer wirtschaftlichen Größe, wie dem Umsatz oder dem Produktionsvolumen. Sie wird häufig als Kilogramm CO₂-Äquivalent pro Euro Umsatz oder pro produzierte Einheit angegeben, abhängig vom Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens. Für Climate VCs ist sie eine der zentralen Kennzahlen.
Dabei ist es wichtig, nicht nur die absoluten Emissionen zu betrachten, sondern auch deren Entwicklung über die Zeit. Ein Unternehmen, dessen Umsatz wächst, während seine CO₂-Intensität sinkt, zeigt eine positive Entkopplung von wirtschaftlichem Wachstum und Emissionen. Die Erfassung sollte konsistent Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Emissionen umfassen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Eine der größten Herausforderungen liegt in der Datenqualität, da Startups oft keine ausgereiften Monitoring-Systeme besitzen. Hier müssen Climate VCs eigene Bewertungsmodelle entwickeln. Die Kombination aus unternehmensinternen Daten und branchenspezifischen Benchmarks hat sich in der Praxis als hilfreich erwiesen.
Vermiedene Emissionen beziehen sich auf die CO₂-Reduktion, die durch die Produkte oder Dienstleistungen eines Portfoliounternehmens erzielt wird – sei es bei den Kunden oder in der Gesellschaft insgesamt. Für Climate VCs ist diese Kennzahl besonders relevant, da sie den systemischen Nutzen ihrer Investitionen verdeutlicht.
Die Berechnung basiert auf dem Vergleich der Emissionen der ersetzten Technologie mit denen der neuen Lösung. Ein Beispiel: Ein Unternehmen, das Dämmmaterialien herstellt, kann über die Lebensdauer der Dämmung pro Quadratmeter eine bestimmte Menge an Heizenergie und den damit verbundenen Emissionen einsparen.
Um Doppelzählungen zu vermeiden, ist eine klare Definition der Ausgangsbasis (Baseline) essenziell. Standards wie das Greenhouse Gas Protocol oder ISO 14064 bieten hier Orientierung. Zudem wird zunehmend eine externe Validierung gefordert, um die Glaubwürdigkeit der Daten zu gewährleisten.
Die Dokumentation vermiedener Emissionen hat nicht nur für Investoren, sondern auch für regulatorische Zwecke an Bedeutung gewonnen. Sie quantifiziert den gesellschaftlichen Nutzen von Climate-Investments und stärkt so die Legitimation für staatliche Förderungen oder steuerliche Vorteile.
Neben den ökologischen Kennzahlen rückt auch der gesellschaftliche Nutzen in den Vordergrund. Der Social Impact pro investiertem Euro stellt die gesellschaftliche Wirkung in Relation zum eingesetzten Kapital und ermöglicht so den Vergleich verschiedener Investment-Optionen.
Typische Indikatoren umfassen die Anzahl geschaffener Arbeitsplätze, Diversitätskennzahlen oder Investitionen in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Bewertung erfolgt oft mithilfe des Social Return on Investment (SROI), der die soziale Wirkung monetarisiert.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Beitrag zur Energiewende und industriellen Transformation. Hierzu zählen Kennzahlen wie die Anzahl der Unternehmen, die durch Portfolio-Unternehmen beim Übergang zu erneuerbaren Energien unterstützt werden, oder die Menge fossiler Brennstoffe, die durch innovative Lösungen ersetzt wird.
Für eine belastbare Analyse ist eine konsistente Datenerhebung und die Definition klarer Bewertungsgrundlagen entscheidend. Climate VCs sollten frühzeitig einheitliche Kriterien und Standards etablieren und diese konsequent über alle Portfoliounternehmen hinweg anwenden.
Die praktische Messung von ESG-Impact erfordert spezialisierte Tools, die sowohl regulatorische Anforderungen erfüllen als auch verlässliche ESG-Daten bereitstellen. Diese Werkzeuge und Methoden sind ein zentraler Bestandteil eines umfassenden ESG-Ansatzes und ermöglichen eine präzise Erfassung der bereits diskutierten Kennzahlen.
Mit LCA-Tools lassen sich die Umweltauswirkungen von Produkten genau quantifizieren. Sie ermöglichen die Berechnung von CO₂-Intensität und vermiedenen Emissionen. Kommerzielle LCA-Softwarelösungen bieten dabei umfangreiche Datengrundlagen und gelten als etablierte Standards. Für kleinere Unternehmen stellt openLCA eine kostenfreie und flexible Alternative dar.
Um diese Tools effektiv einzusetzen, ist eine gut durchdachte Datenstrategie entscheidend. Fachkräfte müssen klare Bewertungsgrenzen definieren, um konsistente und belastbare Ergebnisse für die Impact-Kennzahlen zu erzielen.
ESG-Reporting-Plattformen erleichtern die Datenerfassung und steigern die Effizienz des Reportings. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der definierten ESG-Kennzahlen, auch über größere Portfolios hinweg. Auf den deutschen Markt zugeschnittene Plattformen bieten zudem die Möglichkeit, Daten direkt an relevante Behördenportale zu übermitteln.
Diese Systeme integrieren verschiedene Datenquellen über standardisierte APIs, z. B. für Buchhaltungssoftware oder IoT-Sensoren. Durch automatische Datenerfassung wird der manuelle Aufwand reduziert und das Risiko von Fehlern minimiert – ein klarer Vorteil für ein effizientes Monitoring.
Internationale Standards bieten einen bewährten Rahmen, um ESG-Kennzahlen systematisch zu erfassen. Ein Beispiel ist das Greenhouse Gas Protocol, das mit seiner dreistufigen Scopes-Struktur eine strukturierte Bilanzierung von Treibhausgasemissionen ermöglicht. Besonders der Scope-3-Standard ist für Climate VCs von großer Bedeutung.
Ein weiterer wichtiger Leitfaden ist die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Sie bietet eine strukturierte Grundlage für klimabezogene Finanzberichterstattung, die Aspekte wie Governance, Strategie, Risikomanagement sowie Kennzahlen und Ziele abdeckt. Zusätzlich unterstützt die Science Based Targets Initiative (SBTi) bei der Festlegung und Validierung von Klimazielen.
Ein bewährtes Vorgehen könnte so aussehen: Zunächst werden die Baseline-Emissionen gemäß dem GHG Protocol erfasst. Darauf folgen TCFD-konforme Risikoanalysen und die Entwicklung validierter Reduktionsziele. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für regulatorische Compliance, sondern auch für mehr Transparenz gegenüber Investoren.
Die Einbindung von ESG-Kennzahlen in den gesamten Investmentprozess erfordert einen klar strukturierten Ansatz – von der ersten Prüfung eines Deals bis hin zum Exit. Für Climate VCs bedeutet das, sowohl quantitative Metriken als auch qualitative Bewertungskriterien zu nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf den zuvor definierten Kennzahlen geht es darum, diese gezielt in den Investmentprozess zu integrieren.
Bereits bei der ersten Bewertung potenzieller Investments ist es sinnvoll, ein ESG-Scoring-System zu entwickeln, das sowohl Ausschlusskriterien als auch positive Bewertungsfaktoren umfasst. Ein dreistufiger Filter hat sich dabei bewährt: Zuerst werden Unternehmen ausgeschlossen, die nicht den Klimazielen des Fonds entsprechen. Danach erfolgt die Bewertung anhand quantitativer Kennzahlen, etwa der CO₂-Intensität pro investiertem Euro oder des Potenzials zur Emissionsvermeidung.
Ein zentraler Punkt ist die Skalierbarkeit der Impact-Kennzahlen. Es sollte geprüft werden, wie sich vermiedene Emissionen bei einer Ausweitung des Geschäftsmodells entwickeln. Digitale Geschäftsmodelle im Energiemanagement können hier besonders interessante Profile bieten. Diese erste Analyse legt die Basis für strategische Entscheidungen und fließt in ein umfassendes ESG-Playbook ein.
Für ein effektives Monitoring empfiehlt es sich, regelmäßige und standardisierte ESG-Reports einzuführen. Dabei sollte nicht nur der aktuelle Stand der ESG-Kennzahlen erfasst werden, sondern auch deren Entwicklung über die Zeit. Ein plötzlicher Anstieg der CO₂-Intensität könnte beispielsweise auf operative Herausforderungen hinweisen.
Die Integration von ESG-Themen in Board-Meetings ist ein entscheidender Faktor, um die Klimaziele zu erreichen. VCs sollten daher aktiv daran mitarbeiten, ESG-Governance-Strukturen in ihren Portfoliounternehmen zu etablieren.
Ein Benchmark-System kann dabei helfen, die Performance einzelner Unternehmen sowohl im Vergleich zu internen Standards als auch zu externen Branchenbenchmarks zu bewerten. Die Entwicklung von Impact-KPIs auf Fondsebene schafft darüber hinaus Transparenz für Limited Partners und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Diese kontinuierliche Datenerfassung bildet schließlich die Grundlage für eine fundierte Exit-Strategie.
ESG-Kennzahlen spielen eine immer größere Rolle bei der Exit-Bewertung. Unternehmen mit starker ESG-Performance erzielen bei strategischen Verkäufen oft höhere Bewertungen, da potenzielle Käufer ESG-Risiken zunehmend in ihre Modelle einbeziehen.
Eine lückenlose Dokumentation des ESG-Impacts während der gesamten Beteiligungsdauer wird zu einem entscheidenden Verkaufsargument. Besonders bei komplexen Themen wie Scope-3-Emissionen ist eine frühzeitige Vorbereitung wichtig. Käufer interessieren sich nicht nur für die aktuellen ESG-Kennzahlen, sondern auch für die Fähigkeit des Unternehmens, diese langfristig weiterzuentwickeln.
Die gezielte Ansprache ESG-orientierter Käufer kann zudem einen strategischen Vorteil bringen. Investoren, die selbst Klimaziele verfolgen, erkennen häufig den langfristigen Wert von Unternehmen, die eine transparente und starke ESG-Performance vorweisen können.
Der deutsche Markt für Climate Venture Capital (VC) steht vor einem tiefgreifenden Wandel, angetrieben durch striktere Regulierungen und sich verändernde Marktbedingungen. Mit der Einführung der CSRD im Jahr 2025 und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der EU-Taxonomie entstehen neue Standards, die weit über bisherige Anforderungen hinausgehen. Diese Entwicklungen markieren eine Neuausrichtung im ESG-Management, die nicht nur Chancen, sondern auch neue Herausforderungen mit sich bringt.
Die kommenden Jahre werden von einer deutlichen Verschärfung der Transparenzanforderungen geprägt sein. Ab 2026 müssen Climate VCs ihre eigenen ESG-Daten sowie die ihrer Portfoliounternehmen nach einheitlichen Standards offenlegen. Diese Standardisierung wird die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Investmentmöglichkeiten erheblich verbessern und den Markt transparenter machen.
Die Digitalisierung spielt eine zentrale Rolle in der ESG-Berichterstattung. Investitionen in automatisierte Datenerfassung und Echtzeit-ESG-Dashboards können nicht nur den Aufwand für Compliance reduzieren, sondern auch manuelle Prozesse ersetzen. Unternehmen, die frühzeitig auf solche Technologien setzen, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig erhöht sich der Druck auf Nachzügler, da technologische Effizienz zunehmend über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Ein weiterer Trend ist die zunehmende Marktkonsolidierung. Kleinere Climate VCs, die nicht über spezialisierte ESG-Teams verfügen, haben es zunehmend schwerer, mitzuhalten. Die Folge: Eine Professionalisierung der Branche, bei der spezialisierte ESG-Teams und Impact-Manager zur Grundausstattung gehören. Diese Entwicklung stärkt die Qualität und Effektivität der Investments, erhöht aber auch die Eintrittsbarrieren für neue Akteure.
Fortschritte in der KI-gestützten Analyse eröffnen neue Möglichkeiten. Predictive Analytics helfen, CO₂-Intensität und soziale Impact-Kennzahlen präziser vorherzusagen. Diese datengetriebenen Ansätze ermöglichen es, Investmentstrategien noch zielgerichteter auszurichten und den ökologischen sowie sozialen Nutzen zu maximieren.
Für global agierende Climate VCs wird die Harmonisierung internationaler Standards immer wichtiger. Einheitliche Bewertungskriterien für vermiedene Emissionen und soziale Impacts stehen dabei im Fokus. Gleichzeitig wächst der Druck durch Limited Partners, die nicht nur detaillierte ESG-Reports verlangen, sondern auch eigene Nachhaltigkeitsziele einbringen. Diese steigenden Anforderungen machen ESG-Performance zu einem zentralen Erfolgsfaktor für das Fundraising.
Neben den etablierten ESG-Kennzahlen werden technologische und strukturelle Innovationen immer wichtiger, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Die kommenden Jahre bieten Chancen für diejenigen, die frühzeitig in die richtigen Technologien und Teams investieren und sich auf die neuen Standards einstellen. Der Markt entwickelt sich weiter – und mit ihm die Anforderungen an Climate VCs. Hier ist Weitblick gefragt, um langfristig erfolgreich zu sein.
Die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und die EU-Taxonomie spielen eine zentrale Rolle in der ESG-Berichterstattung von Climate VCs. Mit der CSRD müssen Unternehmen umfassende und standardisierte Berichte über ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen erstellen. Ziel ist es, mehr Transparenz zu schaffen und klare Einblicke in Nachhaltigkeitspraktiken zu geben.
Die EU-Taxonomie ergänzt diese Vorgaben, indem sie eindeutige Kriterien dafür liefert, was als nachhaltige wirtschaftliche Aktivität gilt. Für Climate VCs bedeutet das, Investitionen gezielt dort zu platzieren, wo sie mit den Nachhaltigkeitszielen der EU übereinstimmen. Zusammen sorgen diese Regelwerke für mehr Vergleichbarkeit, Transparenz und Verantwortlichkeit und unterstützen fundierte Entscheidungen bei der Kapitalanlage.
Climate VCs können die Qualität und Vergleichbarkeit von Daten zur CO₂-Intensität und zu vermiedenen Emissionen sichern, indem sie auf standardisierte Methoden und verlässliche Quellen setzen. Dazu zählt die Nutzung bewährter Rahmenwerke wie dem GHG Protocol sowie regelmäßige Kontrollen durch unabhängige Dritte, die die Datenvalidität sicherstellen.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Einsatz spezialisierter Software-Tools, die eine präzise Überwachung und Analyse der Daten ermöglichen. Ebenso entscheidend ist es, das Team in der genauen Erfassung und Bewertung von Daten zu schulen. Mit einem Ansatz, der auf kontinuierliche Optimierung und die Integration bewährter Verfahren setzt, können Climate VCs gewährleisten, dass ihre Entscheidungen auf belastbaren und transparenten Informationen basieren.
Um ESG-Ziele effektiv zu verfolgen und darüber zu berichten, sind spezialisierte digitale Technologien unverzichtbar. Moderne ESG-Softwarelösungen setzen auf Echtzeit-Datenanalysen, künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologien, um Arbeitsprozesse zu automatisieren, die Transparenz zu steigern und Daten lückenlos nachverfolgbar zu machen.
Solche Plattformen bieten Unternehmen die Möglichkeit, ESG-Daten präzise zu erfassen, auszuwerten und zu berichten. Typische Funktionen umfassen etwa die Integration von CO₂-Bilanzen, die Überwachung sozialer Auswirkungen oder die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie der CSRD und der EU-Taxonomie. Mit diesen Technologien lassen sich Nachhaltigkeitsziele nicht nur effizienter erreichen, sondern auch ESG-Strategien gezielt weiterentwickeln.

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonAb 2026 gelten in der EU und Deutschland verbindliche ESG-Vorgaben für Venture-Capital-Fonds. Das...
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stellt neue, verbindliche Anforderungen an...