CSRD vs. NIS2: Cybersecurity-Vergleich
CSRD und NIS2 sind zwei zentrale EU-Regulierungen, die Unternehmen betreffen. Aber was ist der...
Von Johannes Fiegenbaum am 18.08.25 07:29

Wie macht ihr euer Unternehmen krisenfest? Die Antwort liegt in messbaren Resilienz-KPIs. Unternehmen in Deutschland stehen unter wachsendem Druck, ihre Anpassungsfähigkeit nicht nur zu steigern, sondern auch transparent zu dokumentieren – getrieben durch Gesetze wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Doch wie setzt man das praktisch um?
Die 5 wichtigsten KPIs für echte Resilienz:
Unser Fazit: Mit diesen KPIs schafft ihr nicht nur Transparenz, sondern stärkt auch eure Wettbewerbsfähigkeit. Durch klare Messmethoden, Integration in ERP-Systeme und strategische Verknüpfung mit ESG-Zielen könnt ihr eure Resilienz gezielt steuern und dokumentieren. Lasst uns gemeinsam die Chancen nutzen, die in der Messbarkeit von Resilienz stecken.
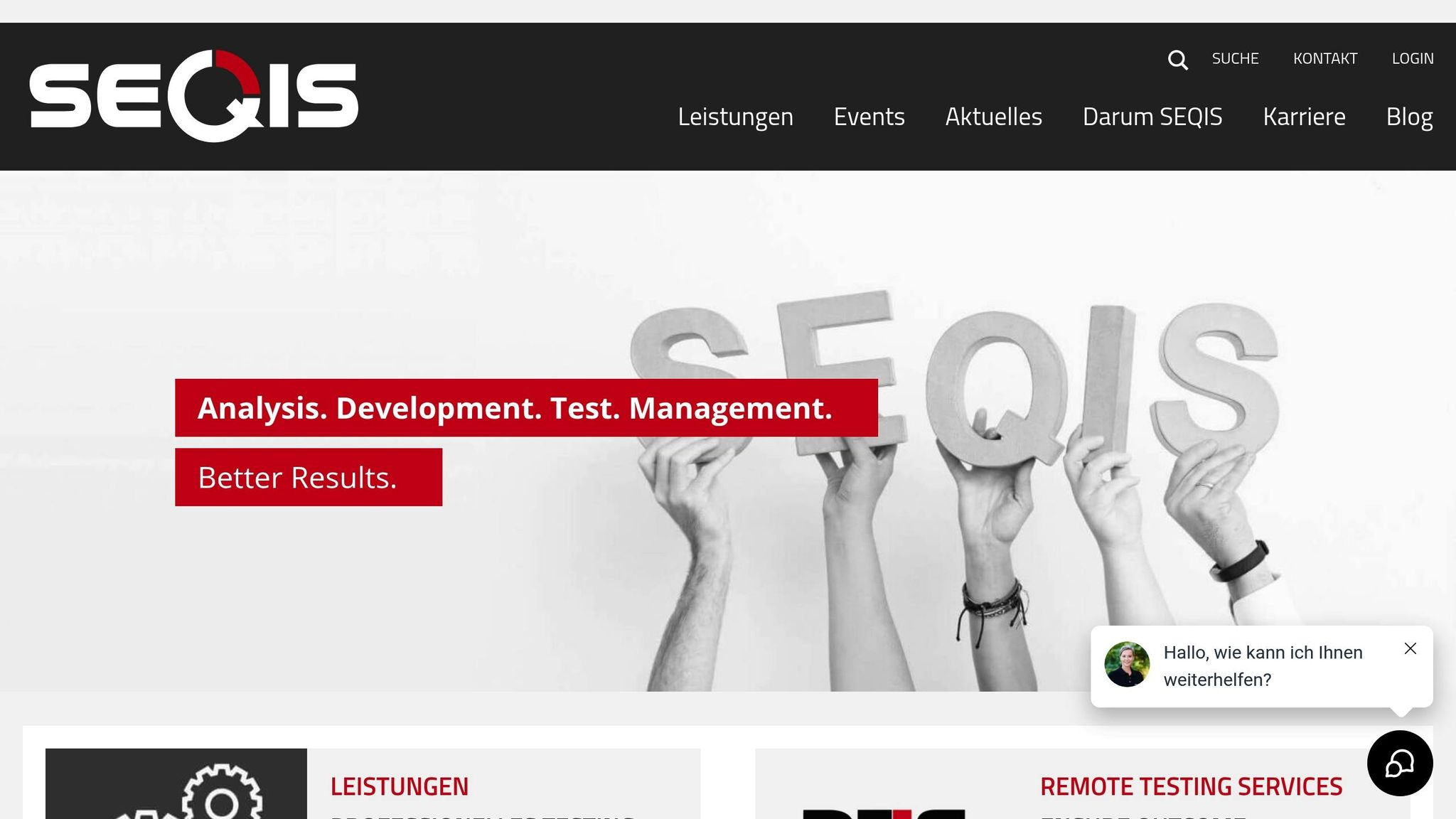
Kennzahlen machen Resilienz greifbar. Viele deutsche Unternehmen haben zwar bereits Nachhaltigkeitsstrategien etabliert, doch oft fehlt es an einer systematischen Erfolgsmessung. KPIs schaffen die notwendige Transparenz, um Anpassungsmaßnahmen gezielt zu steuern und deren Effektivität zu steigern. Doch wie genau tragen KPIs dazu bei, Resilienz messbar und steuerbar zu machen?
Die EU-Taxonomie-Verordnung zeigt deutlich, wie wichtig präzise Messmethoden sind: Unternehmen müssen die Nachhaltigkeit ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten nachvollziehbar dokumentieren. Hier kommen Resilienz-KPIs ins Spiel. Sie liefern nicht nur die Datenbasis, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, sondern helfen auch dabei, operative Schwachstellen aufzudecken und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Diese regulatorischen Vorgaben bieten gleichzeitig eine Grundlage, um KPIs in strategische Maßnahmen zu übersetzen.
Eine klare strategische Ausrichtung entsteht, wenn KPIs eng mit den Unternehmenszielen verknüpft werden. Gerade in einem Umfeld, das von komplexen Lieferketten und einer starken Exportorientierung geprägt ist, braucht es Kennzahlen, die lokale und globale Risiken gleichermaßen abbilden. Erfolgreiche Resilienzstrategien berücksichtigen diese Komplexität, indem sie KPI-Systeme entwickeln, die verschiedene Zeithorizonte und Interessen der Stakeholder einbeziehen.
Die CSRD-Berichtspflicht unterstreicht zusätzlich die Bedeutung von KPIs. Neben reinen Zahlenwerten verlangt sie auch qualitative Einschätzungen zur Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens. KPIs können hier als Brücke dienen, um regulatorische Vorgaben mit strategischen Entscheidungen zu verknüpfen.
Die Integration von Resilienz-KPIs in ERP- und BI-Systeme eröffnet neue Möglichkeiten: Daten können in Echtzeit erfasst und ausgewertet werden. So lassen sich Handlungsempfehlungen und Anpassungsstrategien dynamisch anpassen – ein entscheidender Vorteil in einem sich ständig verändernden Umfeld.
ESG-KPIs spielen zudem eine zentrale Rolle bei der Finanzierung. Sie ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsziele direkt mit günstigen Kreditkonditionen zu verknüpfen, was finanzielle Spielräume schafft und gleichzeitig den Fokus auf Resilienz verstärkt.
Auch das Stakeholder-Management profitiert von transparenten Kennzahlen. Investoren, Kunden und Geschäftspartner erwarten heute detaillierte Informationen zu Klimarisiken und Anpassungsmaßnahmen. KPIs schaffen hier Klarheit und Vertrauen, indem sie komplexe Zusammenhänge verständlich machen. Das stärkt nicht nur die Reputation, sondern eröffnet auch neue Geschäftsmöglichkeiten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sektorspezifität. Deutsche Industriezweige haben unterschiedliche Anforderungen an Resilienz-KPIs. Automobilhersteller konzentrieren sich beispielsweise auf die Resilienz ihrer Lieferketten und Fortschritte bei der Elektrifizierung, während Energieunternehmen Themen wie Netzstabilität und den Ausbau erneuerbarer Energien priorisieren. Erfolgreiche KPI-Systeme berücksichtigen diese branchenspezifischen Anforderungen und liefern Kennzahlen, die sowohl vergleichbar als auch aussagekräftig sind. Sie bilden die Grundlage für eine konsequente Umsetzung und Verbesserung – ein entscheidender Faktor für den Erfolg deutscher Unternehmen.
Die Fähigkeit einer Organisation, sich an Veränderungen anzupassen, bildet das Rückgrat jeder erfolgreichen Strategie zur Resilienz. Dieser KPI bewertet, wie schnell und effizient Unternehmen auf externe Einflüsse reagieren können – sei es durch Klimarisiken, Unterbrechungen in der Lieferkette oder neue regulatorische Vorgaben. Im Gegensatz zu statischen Kennzahlen betrachtet diese Metrik die dynamische Fähigkeit eines Unternehmens, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, ohne dabei seine Kernkompetenzen aus den Augen zu verlieren. Doch wie lässt sich diese Anpassungsfähigkeit konkret messen?
Einige zentrale Indikatoren sind Entscheidungsgeschwindigkeit, die Fähigkeit zur Anpassung von Strukturen, Innovationsraten sowie finanzielle Mittel, die für Anpassungen bereitgestellt werden. Unternehmen in Deutschland können hier beispielsweise die durchschnittliche Zeit von der Problemidentifikation bis zur Umsetzung von Lösungen messen oder den Anteil der Mitarbeitenden, die in den letzten zwölf Monaten Schulungen zu Klimaanpassungsthemen absolviert haben.
Ein entscheidender Faktor für die Anpassungsfähigkeit ist die Entwicklung der Mitarbeitenden. Wichtige Indikatoren sind hier etwa die Zeit, die für Weiterbildungen aufgewendet wird, oder die Anzahl von Projekten, die interdisziplinär auf Nachhaltigkeit abzielen. Denn Klimaanpassung bedeutet nicht nur, auf akute Wetterextreme zu reagieren, sondern auch langfristige Klimatrends in die Geschäftsstrategie zu integrieren.
Praktische Messgrößen umfassen beispielsweise die Reaktionszeit bei klimabedingten Störungen, die Anzahl alternativer Strategien für verschiedene Klimaszenarien oder den Diversifizierungsgrad in klimaresilienten Geschäftsfeldern. Ein Beispiel aus der Industrie: Wie schnell kann die Produktion auf alternative Standorte verlagert werden?
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbindung von Klimadaten in operative Entscheidungen. Dies lässt sich messen, indem man erfasst, wie viele Geschäftsprozesse klimatische Variablen berücksichtigen oder wie häufig Klimadaten in strategischen Entscheidungsprozessen genutzt werden.
Die Integration von ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zeigt sich unter anderem in der Geschwindigkeit, mit der Nachhaltigkeitsziele in operative Prozesse umgesetzt werden. Messbare Indikatoren hierfür sind beispielsweise die Zeit bis zur Implementierung von ESG-Richtlinien, die Anzahl der Abteilungen, die aktiv an Nachhaltigkeitszielen arbeiten, oder der Anteil der Führungskräfte, deren Vergütung an ESG-Leistungen gekoppelt ist.
Unternehmen mit hoher Anpassungsfähigkeit können zudem ihre Aktivitäten schneller an neue regulatorische Anforderungen anpassen. Dies lässt sich daran messen, wie lange es dauert, bis neue Projekte konform zu taxonomiefähigen Kriterien sind, oder am Anteil der Investitionen, die von Beginn an diesen Kriterien entsprechen.
Viele der relevanten Daten – wie Projektlaufzeiten, Weiterbildungsbudgets oder Prozessänderungen – werden bereits in ERP-Systemen erfasst. Die Herausforderung liegt darin, diese Daten intelligent zu verknüpfen, um aussagekräftige Kennzahlen zu generieren. Diese digitale Integration bildet die Basis für gezielte Verbesserungen.
Die Standardisierung solcher Kennzahlen erleichtert zudem das Benchmarking und die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen. Deutsche Unternehmen können branchenspezifische Referenzwerte entwickeln, unterstützt durch etablierte Frameworks wie ISO 14001 oder den Deutschen Nachhaltigkeitskodex.
Die kontinuierliche Überwachung der Anpassungsfähigkeit ermöglicht es, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen – bevor sie sich in operativen Störungen niederschlagen.
Durch die Verknüpfung dieser Kennzahlen mit Anreizsystemen wird die Anpassungsfähigkeit zu einem strategischen Steuerungsinstrument. Führungskräfte werden motiviert, verstärkt in Flexibilität und Innovationskraft zu investieren, was langfristig die Entwicklung der Organisation fördert.
Mit präzisen Messungen können Unternehmen ihre Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten – sei es durch Weiterbildungsprogramme, den Ausbau der IT-Infrastruktur oder organisatorische Umstrukturierungen. So wird die Anpassungsfähigkeit nicht nur gemessen, sondern aktiv gesteigert.
Klimarisiken zu messen und gezielt zu reduzieren, ist eine entscheidende Grundlage für zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Dieser KPI deckt sowohl physische Risiken ab – wie Extremwetter, Überschwemmungen oder Dürren – als auch transitorische Risiken, die durch regulatorische Änderungen, Marktveränderungen oder technologische Neuerungen entstehen. Statt sich ausschließlich auf Schadensbegrenzung zu konzentrieren, können Unternehmen diese Kennzahl nutzen, um Klimarisiken als strategische Chancen zu betrachten und passende Maßnahmen zu entwickeln.
Die Erhebung erfolgt durch eine Kombination aus Bewertung der Exposition und Analyse der Minderungsfortschritte. Dabei wird die Exposition durch Faktoren wie den Anteil klimagefährdeter Geschäftsbereiche, Abhängigkeiten von sensiblen Rohstoffen oder Schwachstellen in der Infrastruktur ermittelt. Fortschritte bei der Risikominderung werden anhand von Schutzmaßnahmen, diversifizierten Lieferketten oder Notfallplänen bewertet. Diese Daten liefern die Grundlage für gezielte und wirksame Klimastrategien.
Deutsche Unternehmen berücksichtigen sowohl kurzfristige Wetterextreme als auch langfristige Klimatrends in ihren Risikomodellen. Physische Risiken können durch Kennzahlen wie die Anzahl klimabedingter Betriebsunterbrechungen, die damit verbundenen Kosten oder die Verfügbarkeit alternativer Standorte konkretisiert werden.
Bei transitorischen Risiken spielen Indikatoren wie der Umsatzanteil aus EU-taxonomiekonformen Aktivitäten, die Zeit bis zur Einhaltung neuer Klimaregelungen oder Investitionen in klimaresiliente Technologien eine Rolle. Besonders wichtig ist die Einbindung von Klimaszenarien in die Geschäftsplanung – etwa durch die Anzahl berücksichtigter Klimapfade oder die regelmäßige Aktualisierung von Risikomodellen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Effektivität von Frühwarnsystemen: Wie schnell können klimabedingte Risiken erkannt und kommuniziert werden? Dies umfasst sowohl technische Überwachungssysteme als auch organisatorische Prozesse, die eine schnelle Reaktion ermöglichen.
Die Bedeutung von Klimarisiken in der ESG-Berichterstattung wächst – nicht zuletzt durch Vorgaben wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die EU-Taxonomie. Wichtige Indikatoren sind hier der Anteil taxonomiefähiger Aktivitäten und die Integration von Klimadaten in Finanzberichte.
Für die Scope-3-Emissionen in der Lieferkette sind relevante Kennzahlen unter anderem der Anteil der Lieferanten mit eigenen Klimazielen, die durchschnittliche CO₂-Intensität pro eingekauftem Euro oder die Anzahl alternativer Lieferanten für kritische Komponenten. Solche Daten helfen, Abhängigkeiten zu minimieren und gleichzeitig regulatorische Vorgaben einzuhalten.
Investitionen in Klimaresilienz lassen sich sowohl als Prozentsatz der Gesamtinvestitionen als auch als absolute Summe in Euro pro Jahr darstellen. Dabei ist es entscheidend, präventive Maßnahmen von reaktiven Anpassungen zu unterscheiden, da erstere langfristig oft kosteneffizienter sind.
Viele der benötigten Klimarisiko-Daten sind bereits in bestehenden Systemen verfügbar oder können mit geringem Aufwand erhoben werden. Operative Kennzahlen wie Produktionsausfälle, Transportverzögerungen oder Schwankungen bei Rohstoffpreisen werden häufig schon erfasst und müssen lediglich um klimaspezifische Kategorien ergänzt werden.
Auch finanzielle Indikatoren wie klimabedingte Versicherungskosten, Investitionen in Anpassungsmaßnahmen oder Mehrkosten durch alternative Beschaffungswege sind meist in ERP- oder Controlling-Systemen hinterlegt. Durch entsprechende Zuordnungen können diese Daten klimaspezifisch ausgewertet werden.
Die Qualität der Daten lässt sich anhand von Kriterien wie der Anzahl der Standorte mit Klimamonitoring, der Häufigkeit von Risikoanalysen oder der Vollständigkeit der Lieferantendaten bewerten. Standardisierte Frameworks wie die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) bieten dabei klare Strukturen für eine konsistente Datenerfassung. So werden die erhobenen Informationen zu einem integralen Bestandteil der übergeordneten Resilienzstrategie.
Die systematische Erhebung und Nutzung dieser Daten führt zu klaren Handlungsoptionen. Kontinuierliches Monitoring ermöglicht es, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, etwa Produktionszyklen an saisonale Wetterbedingungen anzupassen, Lagerbestände vor kritischen Perioden zu erhöhen oder alternative Transportrouten zu entwickeln.
Klar definierte KPIs unterstützen zudem fundierte Investitionsentscheidungen. Unternehmen können etwa langfristige klimatische Entwicklungen in Standortanalysen einfließen lassen, Technologieinvestitionen auf Klimaresilienz ausrichten oder Lieferantenverträge mit entsprechenden Klauseln versehen. Auch Anreizsysteme – wie klimarisiko-angepasste Boni für das Management – unterstreichen die strategische Bedeutung des Themas.
Durch die Monetarisierung von Klimarisiken wird der Return on Investment von Anpassungsmaßnahmen messbar. Dies umfasst sowohl eingesparte Kosten durch präventive Maßnahmen als auch zusätzliche Einnahmen durch klimaresiliente Geschäftsmodelle. Mit diesen Ansätzen können Unternehmen ihre strategischen Entscheidungen stärken und gleichzeitig neue Optimierungsmöglichkeiten erschließen.
Die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten ist für deutsche Unternehmen mehr als nur ein Schutz vor Störungen – sie ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Der Supply Chain Resilience Index misst, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, Unterbrechungen in der Lieferkette vorherzusehen, darauf zu reagieren und sich schnell davon zu erholen. Dabei geht er über herkömmliche Effizienzkennzahlen hinaus und bewertet Aspekte wie die Diversifikation der Lieferanten, die geografische Verteilung kritischer Komponenten, alternative Beschaffungswege und die Geschwindigkeit, mit der auf Störungen reagiert werden kann.
Was den Index besonders nützlich macht: Er berücksichtigt sowohl kurzfristige Schocks als auch langfristige strukturelle Veränderungen. Unternehmen können so Schwachstellen identifizieren und gezielt in widerstandsfähige Strukturen investieren. Gleichzeitig unterstützt der Index dabei, stabile Partnerschaften aufzubauen – ein Ansatz, der auch eng mit den regulatorischen Anforderungen und ESG-Zielen verbunden ist, die wir im nächsten Abschnitt näher beleuchten.
Seit dem 1. Januar 2023 müssen deutsche Unternehmen den Vorgaben des Lieferkettengesetzes (LkSG) entsprechen. Dieses Gesetz gilt zunächst für Unternehmen mit über 3.000 Beschäftigten und ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden. Es verlangt, dass entlang der Lieferkette umfassende Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz eingehalten werden. Dazu gehören Risikomanagementsysteme, Risikoanalysen, präventive Maßnahmen und Beschwerdemechanismen.
Der Supply Chain Resilience Index hilft Unternehmen, diese Anforderungen zu erfüllen, indem er Prozesse zur Identifikation, Bewertung und Minderung von Risiken integriert. Mit der bevorstehenden EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) werden die Anforderungen noch strenger: Im Vergleich zum LkSG sieht diese Richtlinie eine zivilrechtliche Haftung für Verstöße vor.
Ein weiteres Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Berücksichtigung von Scope-3-Emissionen in der Lieferkettenberichterstattung. Regelungen wie Kaliforniens SB 253 zeigen, wie eng Lieferkettenresilienz und Klimarisikomanagement miteinander verbunden sind. Der Index bietet Unternehmen eine Möglichkeit, sowohl ihre ESG-Ziele zu erreichen als auch die regulatorischen Vorgaben einzuhalten.
Der Supply Chain Resilience Index ist ein wichtiger Baustein für eine umfassende Resilienzstrategie, insbesondere im Hinblick auf Klimarisiken. Klimabedingte Störungen in Lieferketten erfordern eine präzise Erfassung klimaspezifischer Schwachstellen. Der Index berücksichtigt dabei Faktoren wie den Anteil kritischer Lieferanten in klimagefährdeten Regionen, die Vorlaufzeiten für alternative Beschaffungsquellen und die Verfügbarkeit von Backup-Lieferanten.
Auch die Klimaresilienz der Lieferanten selbst spielt eine Rolle. Kriterien wie Klimaanpassungspläne, Investitionen in widerstandsfähige Infrastruktur und die Reaktionsfähigkeit auf wetterbedingte Störungen fließen in die Bewertung ein. Zusätzlich wird die Transportresilienz analysiert – beispielsweise durch alternative Routen, multimodale Logistikoptionen und die Bewertung kritischer Infrastrukturen wie Häfen oder Bahnknotenpunkte.
Viele der Daten, die für den Supply Chain Resilience Index benötigt werden, sind bereits in bestehenden ERP-Systemen, Supplier-Management-Plattformen oder Beschaffungstools verfügbar. Kennzahlen wie Lieferantenzahl, Bestellvolumen oder Lieferzeiten lassen sich problemlos um Resilienz-Dimensionen erweitern. Operative Metriken wie die Dauer der Lieferantenqualifikation oder der Anteil strategischer Partnerschaften können direkt aus den Beschaffungssystemen abgeleitet werden. Auch finanzielle Indikatoren wie Mehrkosten durch Eilbestellungen oder Lagerkosten für Sicherheitsbestände sind oft im Controlling hinterlegt.
Die Datenqualität wird durch standardisierte Lieferantenbewertungen, regelmäßige Audits oder digitale Monitoring-Tools gewährleistet. Viele Unternehmen erweitern ihre bestehenden Supplier Scorecards um Resilienz-Kriterien, sodass keine komplett neuen Systeme nötig sind. Automatisierte Datenerfassung – etwa durch IoT, GPS-Tracking oder API-Verbindungen – reduziert den manuellen Aufwand erheblich und ermöglicht ein Echtzeit-Monitoring von Lieferstatus, Lagerbeständen und Transportbewegungen.
Der gezielte Einsatz des Supply Chain Resilience Index eröffnet konkrete Handlungsmöglichkeiten, um Risiken zu minimieren und neue Chancen zu nutzen. Präventive Maßnahmen wie der Aufbau alternativer Lieferquellen, strategischer Lagerbestände oder flexibler Vertragsstrukturen können mithilfe klar definierter KPIs gesteuert werden. Darüber hinaus erleichtert der Index die gezielte Weiterentwicklung von Lieferanten, indem er Resilienzlücken systematisch aufzeigt – ein entscheidender Schritt, um die Stabilität der Lieferkette und des Unternehmens langfristig zu sichern.
Dieser KPI schafft eine direkte Verbindung zwischen Nachhaltigkeitszielen und der finanziellen Leistung eines Unternehmens. Er zeigt auf, wie ESG-Initiativen zentrale Finanzkennzahlen wie Kapitalrendite, Finanzierungskosten oder die Marktbewertung beeinflussen. Dabei geht es nicht nur um isolierte Betrachtungen, sondern um die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen nachhaltiger Geschäftspraktiken.
Der Fokus liegt sowohl auf kurzfristigen Kosteneffekten als auch auf langfristigen Wertsteigerungen, die durch eine stärkere ESG-Performance erzielt werden können. Unternehmen können so belegen, dass Investitionen in Nachhaltigkeit nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Diese Verbindung ist entscheidend, um Stakeholder von der Rentabilität nachhaltiger Strategien zu überzeugen und kontinuierliche Investitionen in Resilienzmaßnahmen zu rechtfertigen.
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU, die seit dem 1. Januar 2024 schrittweise eingeführt wird, verpflichtet deutsche Unternehmen zu detaillierten Berichten über ihre Nachhaltigkeitsleistung. Ab 2028 müssen große Unternehmen und börsennotierte KMU ihre ESG-Daten gemäß den ESRS offenlegen. Ein KPI wie die ESG-gebundene Finanzperformance hilft dabei, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Vorteile der Compliance zu dokumentieren.
Auch die EU-Taxonomie-Verordnung spielt eine wichtige Rolle. Unternehmen müssen den Anteil taxonomiekonformer Umsätze, Investitionen und Betriebsausgaben ausweisen. Mit dem wachsenden Fokus auf Sustainable Finance wird die Verbindung von ESG-Zielen und finanzieller Performance immer bedeutender. Deutsche Banken berücksichtigen ESG-Kriterien zunehmend bei der Kreditvergabe, während institutionelle Investoren Nachweise für die Rentabilität nachhaltiger Geschäftsmodelle verlangen.
Der KPI macht Klimarisiken und -chancen finanziell messbar und steuerbar. Physische Klimarisiken, wie Extremwetterereignisse, können hohe Kosten verursachen – von Produktionsausfällen bis hin zu Infrastrukturschäden. Der KPI zeigt, wie präventive Maßnahmen diese Kosten senken und die operative Stabilität stärken können.
Auch Transitionsrisiken, die sich aus dem Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, werden berücksichtigt. Investitionen in Energieeffizienz oder erneuerbare Energien mögen zunächst kostenintensiv sein, führen jedoch mittelfristig zu niedrigeren Betriebskosten und verringern regulatorische Risiken. Der KPI hilft, diese Investitionen zu rechtfertigen und ihre Rentabilität zu überwachen.
Darüber hinaus hebt der KPI Klimachancen hervor, die sich aus der Transformation ergeben. Unternehmen, die frühzeitig auf klimaresiliente Geschäftsmodelle setzen, können neue Märkte erschließen, Wettbewerbsvorteile sichern und von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten profitieren. Diese finanziellen Effekte werden kontinuierlich überwacht und in die strategische Planung integriert.
Die meisten Daten für diesen KPI sind bereits in den bestehenden Finanz- und Controllingsystemen verfügbar. Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA, Kapitalrendite oder Finanzierungskosten werden ohnehin regelmäßig erfasst und können direkt mit ESG-Initiativen verknüpft werden. Ergänzende ESG-Daten, etwa zu Energiekosten, CO₂-Abgaben oder Nachhaltigkeitsprojekten, lassen sich aus der Kostenstellenrechnung ableiten.
Moderne ERP-Systeme wie SAP oder Oracle erleichtern die automatisierte Datenerfassung. Mithilfe von Business-Intelligence-Tools können diese Daten in Echtzeit analysiert und visualisiert werden, um den Zusammenhang zwischen ESG-Performance und Finanzleistung aufzuzeigen.
Die Integration des KPIs in bestehende Reporting-Zyklen ist unkompliziert. Quartals- und Jahresberichte können problemlos um ESG-Metriken erweitert werden. Auch Management-Dashboards lassen sich anpassen, sodass Führungskräfte die finanziellen Auswirkungen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie jederzeit im Blick behalten.
Dieser KPI unterstützt datenbasierte Entscheidungen bei Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte. Statt ESG-Initiativen als reine Kostenfaktoren zu betrachten, können Unternehmen deren Return on Investment systematisch bewerten. Energieeffizienzmaßnahmen lassen sich etwa anhand ihrer Amortisationszeit und langfristigen Einsparpotenziale beurteilen, während Investitionen in erneuerbare Energien durch niedrigere Energiekosten und geringere CO₂-Abgaben gerechtfertigt werden können.
Darüber hinaus erleichtert der KPI die Kommunikation mit Stakeholdern. Investoren, Banken und Geschäftspartner erhalten klare Nachweise dafür, dass Nachhaltigkeitsinitiativen nicht nur ethisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich lohnend sind. Diese Transparenz kann zu besseren Finanzierungskonditionen führen, da ESG-orientierte Kreditgeber und Investoren nachhaltige Unternehmen oft mit günstigeren Zinsen oder höheren Bewertungen belohnen.
Operative Verbesserungen werden durch das fortlaufende Monitoring der Finanzperformance gefördert. Teams können identifizieren, welche Maßnahmen den größten finanziellen Einfluss haben, und gezielt weitere Optimierungen vornehmen. So wird die ESG-gebundene Finanzperformance zu einem zentralen Bestandteil einer umfassenden Resilienzstrategie.
Dieser KPI misst das Vertrauen und die Beteiligung verschiedener Interessengruppen – von Investoren und Kunden bis hin zu Mitarbeitern und Gemeinden. Er zeigt, wie erfolgreich ein Unternehmen durch offene Kommunikation, glaubwürdige Nachhaltigkeitspraktiken und stabile Partnerschaften seine Geschäftsgrundlage stärkt und wettbewerbsfähig bleibt.
Der Index kombiniert messbare Größen wie Kundenbindungsraten, Mitarbeiterfluktuation oder die Zufriedenheit von Investoren mit qualitativen Einschätzungen zur Stakeholder-Kommunikation. Besonders in Krisenzeiten wird der Nutzen dieses KPIs deutlich: Unternehmen mit hohem Vertrauen können schneller auf Herausforderungen reagieren, erhalten leichter Unterstützung bei wichtigen Entscheidungen und sichern sich eine stabile Basis für die Zukunft. Im Folgenden betrachten wir, wie dieser Index durch eine Mischung aus Daten und Bewertungen die strategische Steuerung unterstützt.
Die EU-Richtlinie zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erweitert die Berichtspflichten in Deutschland massiv – von bisher 550 auf rund 15.000 Unternehmen. Damit wird das Engagement mit Stakeholdern zu einem zentralen Bestandteil der ESG-Berichterstattung. Unternehmen müssen nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit berichten: Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsrisiken ihr Geschäft, und welche Auswirkungen haben sie selbst auf nachhaltigkeitsbezogene Themen?
Zusätzlich betont das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das seit dem 1. Januar 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden gilt, die Bedeutung von Stakeholder-Engagement. Unternehmen sind verpflichtet, mit wichtigen Partnern entlang der Wertschöpfungskette zusammenzuarbeiten, um ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen.
Angesichts der zunehmenden Überprüfung von Greenwashing ist es wichtiger denn je, glaubwürdige ESG-Aussagen zu machen. Ein systematischer Ansatz im Stakeholder-Engagement hilft dabei, vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und transparent zu kommunizieren.
Das Vertrauen der Stakeholder spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung von Klimarisiken. Physische Risiken wie Extremwetterereignisse erfordern oft schnelle Entscheidungen und die Unterstützung verschiedener Gruppen. Unternehmen mit etablierten Vertrauensstrukturen können in solchen Situationen auf die Zusammenarbeit von Mitarbeitenden, Lieferanten und lokalen Gemeinschaften zählen, etwa bei Produktionsverlagerungen oder Investitionen in klimaresiliente Infrastrukturen.
Auch bei Transitionsrisiken – etwa durch den Wechsel zu kohlenstoffarmen Geschäftsmodellen – ist ein intensives Stakeholder-Engagement essenziell. Kunden müssen von neuen, nachhaltigeren Produkten überzeugt werden, Investoren brauchen klare Informationen zu Kosten und Nutzen der Transformation, und Mitarbeitende erwarten Sicherheit in einer sich wandelnden Unternehmensstruktur. Ein hoher Trust-Index erleichtert solche Übergangsprozesse erheblich.
Darüber hinaus eröffnen sich Chancen: Nachhaltige Innovationen profitieren von direktem Kundenfeedback, während Investoren vertrauenswürdigen Unternehmen eher langfristige Wachstumsstrategien unterstützen. Auch Kooperationen mit NGOs oder Forschungseinrichtungen lassen sich auf Basis solider Vertrauensbeziehungen leichter realisieren.
Viele der für diesen KPI erforderlichen Daten sind bereits in den bestehenden Systemen eines Unternehmens verfügbar. Kundenzufriedenheitswerte aus CRM-Systemen, Mitarbeiterbindungsraten aus HR-Datenbanken oder Investorenfeedback können direkt genutzt werden. Mit modernen Umfragetools lässt sich zusätzlich gezielt Stakeholder-Feedback zu Nachhaltigkeitsthemen erfassen.
Auch Social-Media-Monitoring bietet Einblicke in die öffentliche Wahrnehmung und das Vertrauen in Echtzeit. Diese Daten können mit traditionellen Kennzahlen kombiniert werden, um ein umfassendes Bild des Stakeholder-Vertrauens zu erhalten. Zudem fließen externe Bewertungen von ESG-Rating-Agenturen wie S&P, Sustainalytics oder MSCI in den Index ein. Die Deutsche Börse Group strebt beispielsweise an, bei drei führenden ESG-Ratings unter den besten 10 % zu bleiben. Solche Benchmarks stärken die Glaubwürdigkeit der eigenen Bewertung und bieten Ansatzpunkte für gezielte Maßnahmen.
Der Index ermöglicht es, potenzielle Vertrauensprobleme frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. Wenn z. B. die Kundenzufriedenheit bei Nachhaltigkeitsthemen sinkt oder Investoren Bedenken zur Klimastrategie äußern, können Unternehmen schnell reagieren – ein klarer Vorteil in einer Zeit, in der ESG-Themen immer stärker im Fokus stehen.
Darüber hinaus hilft der Index, Kommunikationsstrategien präzise auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen – Investoren, Kunden oder Mitarbeitende – abzustimmen. Der Stakeholder Trust and Engagement Index bietet somit eine praxisorientierte Grundlage, um ESG-Maßnahmen kontinuierlich zu verbessern und den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern.
Die Einführung der fünf Resilienz-KPIs erfordert durchdachte technische und organisatorische Maßnahmen. Deutsche Unternehmen stehen dabei vor der Aufgabe, sowohl nationale als auch europäische Berichtspflichten zu erfüllen und gleichzeitig effektive Steuerungsinstrumente zu entwickeln. Mit klaren Zielen und einer dashboard-basierten Überwachung lassen sich Strategien in Echtzeit steuern und anpassen.
Moderne Dashboards bieten die Möglichkeit, alle fünf KPIs in Echtzeit abzubilden. Diese Systeme verknüpfen Daten aus verschiedenen Quellen – von ERP-Systemen und HR-Datenbanken bis hin zu externen Klimadatenanbietern – und ermöglichen so eine kontinuierliche Überwachung der Resilienz-Performance.
Automatisierte Datenerfassungen senken den Aufwand und minimieren Fehlerquellen. Gerade bei Supply-Chain-Daten oder Klimarisikoindikatoren sparen automatisierte Integrationen wertvolle Zeit und verbessern die Datenqualität erheblich.
Ein weiterer Vorteil: Frühwarnsysteme. Fällt beispielsweise der Supply Chain Resilience Index unter einen festgelegten Schwellenwert oder steigt die Klimarisikoexposition, können automatische Benachrichtigungen an die zuständigen Teams gesendet werden. So lassen sich frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten.
Ein zentrales Compliance-Dashboard hilft, alle KPI-Daten gemäß CSRD und LkSG zu erfassen. Dabei ist das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit entscheidend: Es gilt, sowohl die finanziellen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken als auch die eigenen Einflüsse auf nachhaltigkeitsbezogene Themen transparent darzustellen.
Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) liefern dafür klare Vorgaben. Besonders relevant sind die Standards ESRS E1 (Klimawandel), ESRS S1 (Eigene Belegschaft) und ESRS G1 (Unternehmenspolitik). Diese lassen sich direkt mit den Resilienz-KPIs verknüpfen und bieten eine strukturierte Grundlage für die Berichterstattung.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der KPI-Ziele und deren Fortschritt:
| KPI | Baseline (2023) | Zielwert (2025) | Aktueller Wert | Status |
|---|---|---|---|---|
| Organizational Adaptive Capacity | 65,4 % | 80,0 % | 72,1 % | ↗ |
| Climate Risk Mitigation Progress | 1.234.567,89 € | 2.500.000,00 € | 1.876.543,21 € | ↗ |
| Supply Chain Resilience Index | 7,2 | 8,5 | 7,8 | ↗ |
| ESG-Linked Financial Performance | 12,3 % | 15,0 % | 13,7 % | ↗ |
| Stakeholder Trust Index | 78,9 % | 85,0 % | 81,2 % | ↗ |
Diese kompakte Darstellung ermöglicht es Führungskräften, Fortschritte auf einen Blick zu erkennen und bei Bedarf gezielte Maßnahmen einzuleiten.
Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen die neuen Resilienz-KPIs nahtlos in bestehende Berichtsprozesse eingebunden werden. Viele deutsche Unternehmen verfügen bereits über ausgefeilte Controlling-Systeme, die sich anpassen und erweitern lassen.
Die Berichtszyklen sollten dabei sorgfältig abgestimmt werden. Während einige KPIs, wie der Stakeholder Trust Index, monatliche Updates erlauben, benötigen andere – etwa der Climate Risk Mitigation Progress – möglicherweise quartalsweise Bewertungen. Eine Harmonisierung dieser Zyklen mit den bestehenden Finanzberichtsprozessen reduziert den administrativen Aufwand und schafft Synergien.
Die Aussagekraft der KPIs steht und fällt mit der Qualität der zugrunde liegenden Daten. Deshalb sollten Unternehmen robuste Validierungsprozesse etablieren, die sowohl interne Plausibilitätsprüfungen als auch externe Verifizierungen umfassen.
Für die Bewertung von Klimarisiken können beispielsweise Daten von anerkannten Anbietern wie dem Deutschen Wetterdienst oder anderen europäischen Klimadiensten genutzt werden. Bei Supply-Chain-Daten bietet sich die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern an, die regelmäßig aktualisierte Informationen zu Lieferantenrisiken bereitstellen.
Wichtig ist auch die Dokumentation der Datenquellen und Berechnungsmethoden – sowohl für die interne Nachvollziehbarkeit als auch für die Compliance.
Die Überwachung und Umsetzung der KPIs sollte klar in der Organisationsstruktur verankert sein. Viele Unternehmen setzen dafür auf spezialisierte Sustainability- oder Resilience-Committees. Diese Gruppen bewerten regelmäßig die KPI-Performance und initiieren bei Bedarf Verbesserungsmaßnahmen.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen – von Controlling und Risk Management bis hin zu Sustainability und Investor Relations – sorgt für eine umfassende Betrachtung der Resilienz-Performance. Regelmäßige Schulungen und Workshops fördern darüber hinaus das Verständnis für die KPIs innerhalb der gesamten Organisation und unterstützen eine datenbasierte Entscheidungskultur.
Die vorgestellten KPIs bieten eine klare Grundlage, um Resilienz messbar zu machen und Unternehmen dabei zu helfen, sich zukunftssicher aufzustellen. Durch diese Kennzahlen können deutsche Unternehmen nicht nur ihre Innovationskraft mit der Organizational Adaptive Capacity stärken, sondern auch Einsparpotenziale durch Fortschritte im Bereich Climate Risk Mitigation realisieren.
Die Verbindung von Resilienz-Strategien mit ESG-Zielen reduziert operative Risiken und senkt gleichzeitig Compliance-Kosten. Besonders der ESG-Linked Financial Performance Indikator verdeutlicht, wie nachhaltige Geschäftspraktiken direkt zu finanziellen Vorteilen führen können.
Mit dashboardbasierten KPIs wird eine Transparenz geschaffen, die datenbasierte Entscheidungen erleichtert und das Vertrauen von Investoren und Geschäftspartnern stärkt. Der Stakeholder Trust Index gibt zudem einen klaren Einblick in die Kapitalmarktfähigkeit und Partnerschaftseignung eines Unternehmens.
Diese strategische KPI-Methode baut auf den vorher beschriebenen Ansätzen auf und liefert praktische Werkzeuge für die Umsetzung. Fiegenbaum Solutions bietet hierzu spezialisierte Beratung an, um Unternehmen bei der Entwicklung maßgeschneiderter KPI-Systeme zu unterstützen. Johannes Fiegenbaum steht Unternehmen als unabhängiger Berater zur Seite, sei es bei Klimarisikobewertungen, CSRD-konformer Berichterstattung oder der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle.
Die systematische Messung von Resilienz ist keine Zukunftsmusik, sondern bereits heute ein entscheidender Erfolgsfaktor – und wird in den kommenden Jahren für nachhaltig agierende Unternehmen unverzichtbar werden.
Unternehmen haben die Möglichkeit, die Resilienz ihrer Organisation durch gezielte KPIs (Key Performance Indicators) zu bewerten. Zu den zentralen Kennzahlen gehören die Innovationsrate, die Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, das Engagement der Mitarbeitenden, die Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen sowie die Zufriedenheit der Kundschaft. Diese Indikatoren bieten eine klare Orientierung, wie gut die Organisation auf Herausforderungen reagieren und sich anpassen kann.
Um die Widerstandsfähigkeit gezielt zu verbessern, empfiehlt es sich, regelmäßige Analysen durchzuführen. Das können beispielsweise Mitarbeiterbefragungen oder Performance-Reviews sein. Dabei ist es entscheidend, sowohl quantitative als auch qualitative Daten zu nutzen. So lassen sich Schwachstellen frühzeitig identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Optimierung einleiten. Ein konsequenter Fokus auf diese Metriken trägt dazu bei, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität des Unternehmens zu sichern.
Die Einbindung von Resilienz-KPIs in ERP- und BI-Systeme bringt Unternehmen einen entscheidenden Vorteil: Sie können datenbasierte Entscheidungen treffen, die durch klare und übersichtliche Visualisierungen unterstützt werden. Dadurch lassen sich Geschäftsprozesse flexibler und widerstandsfähiger gestalten, während Risiken frühzeitig erkannt und gemanagt werden können.
Mit dieser Integration können Unternehmen ihre Lieferketten stabiler aufstellen, schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, ESG-Ziele zu erreichen und Klimarisiken effizienter zu bewältigen.
Der Stakeholder Trust and Engagement Index bietet Unternehmen ein wertvolles Werkzeug, um gezielt das Vertrauen ihrer Interessengruppen zu analysieren und zu stärken. Warum ist das so wichtig? Vertrauen beeinflusst nicht nur die Qualität von Geschäftsbeziehungen, sondern wirkt sich auch direkt auf die Motivation eurer Mitarbeitenden und die Loyalität eurer Kundschaft aus.
Indem ihr den Index regelmäßig auswertet und in eure strategischen Entscheidungen einfließen lasst, könnt ihr frühzeitig auf die Bedürfnisse eurer Stakeholder reagieren. Besonders in Krisenzeiten zeigt sich der Nutzen: Stabilere Beziehungen und eine gestärkte Widerstandsfähigkeit der gesamten Organisation. Dabei sind klare Zielsetzungen und eine transparente Kommunikation der Schlüssel, um Vertrauen nicht nur aufzubauen, sondern auch langfristig zu sichern.

ESG- und Nachhaltigkeitsberater mit Schwerpunkt auf VSME‑Berichterstattung und Klimarisikoanalysen. Begleitet seit 2014 über 300 Projekte für den Mittelstand und Konzerne – unter anderem Commerzbank, UBS und Allianz.
Zur PersonCSRD und NIS2 sind zwei zentrale EU-Regulierungen, die Unternehmen betreffen. Aber was ist der...
Biodiversität ist ein Schlüsselthema für moderne ESG-Strategien. Unternehmen müssen verstehen, wie...
Die nächsten fünf Jahre werden entscheidend für Unternehmen, die ESG (Umwelt, Soziales,...